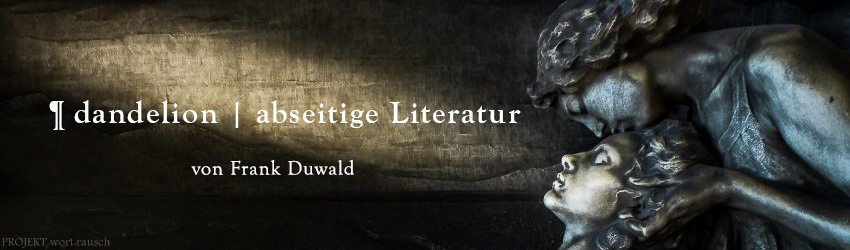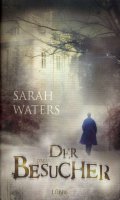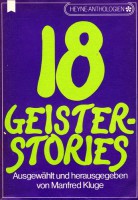Originalveröffentlichung:
The Little Stranger (2009)
Sarah Waters ist schon eine mutige Autorin. Nachdem sie sich mit vier preisgekrönten und in den Bestsellerlisten ansässigen Romanen mit hauptsächlich lesbischen Charakteren in die Herzen ihrer Leser geschrieben hat, wagt sie es, mit ihrem fünften Roman The Little Stranger Neuland zu betreten. Denn zum einen wird The Little Stranger in erster Person aus der Perspektive eines Mannes erzählt, zum anderen wählt Waters, nachdem sie in ihrem zweiten Roman Affinity [Selinas Geister] noch davor gekniffen hat, die Abzweigung, die das Übernatürliche in ihre Zeilen einlässt. In der Form einer postmodernen epischen Geistergeschichte zieht sich Waters insbesondere die Auswirkungen des 2. Weltkriegs auf das britische Standessystem in den Fokus.
Der umfangreiche Roman beginnt mit Glanz und Gloria im Jahr 1919, als der 10-jährige Erzähler Faraday (sein Vorname bleibt Geheimnis), einer der bürgerlichen Schaulustigen anlässlich eines großen Festes der Ayres‘, zum ersten Mal dem prunkvollen georgianischen Herrenhaus Hundreds Hall nahe kommt. In einer Szene, die die Saat des nachfolgenden Romans legt, gelingt es Faraday durch seine Mutter, die in Hundreds Hall beim Hauspersonal gearbeitet hat, ins Innere des Herrenhauses zu gelangen. Als er in einem Raum ein Stuckfries sieht, bricht er aus einem Relief aus Eicheln eine Eichel heraus und steckt sie ein. Seine Begründung dafür lautet: „Ich wollte mir einen Teil der Schönheit sichern, gerade so, wie ein Mann sich eine Locke von dem Haar des Mädchens bewahren möchte, in das er sich unsterblich verliebt hat.“
Fast dreißig Jahre später, 1947, führt ein Zufall Faraday erneut nach Hundreds Hall. Er ist inzwischen der Landarzt Dr. Faraday, und in Vertretung für den eigentlichen Hausarzt der Ayres‘ betritt er erneut Hundreds Hall. Die Ayres‘, einst eine der einflussreichsten Familien der Gegend, bestehen aus der über 50-jährigen Mrs. Ayres und ihren beiden Kindern, dem Kriegsverletzten Roderick und der Tochter Caroline, die, obwohl erst etwa sieben- oder achtundzwanzig Jahre alt, bereits den Ruf einer altjungferlichen, leicht verschrobenen Frau hat. Dr. Faraday fällt insbesondere ins Auge, in welchem Ausmaß der Krieg den Status der Ayres‘ nach unten korrigiert hat. Zwar besitzen sie noch das riesige Herrenhaus und das umliegende Land, aber ansonsten sind sie verarmt und leben von der Hand im Mund. Hundreds Hall glänzt nicht mehr, wie Faraday es vor vielen Jahren zuletzt gesehen hat. Die Gärten sind verwildert, das Haus ist vom Zahn der Zeit angefressen, und ganze Hausflügel sind abgesperrt.
Die nächsten zwei- bis dreihundert Seiten widmet sich Sarah Waters in aller Ruhe dem Aufbau ihrer Charaktere. Die Charaktere wachsen mit jeder Seite unauffällig, und Dr. Faraday wird zunehmend ein Freund des Hauses. Er besucht die Ayres‘ jetzt bei jeder sich bietenden Gelegenheit, behandelt den Kriegsversehrten Roderick mit einer Elektrotherapie, gewinnt das Vertrauen der immer noch ihrem Erbe verhafteten Mrs. Ayres und freundet sich mit der unkonventionellen Caroline an.
Und immer wieder Hundreds Hall, das Waters mit einem unglaublichen Detailreichtum beschreibt. Aber auch, wenn Hundreds Hall kontinuierlich an Charakter gewinnt, scheint es auf dem absteigenden Ast. Wie ein Organismus beginnt das Gebäude ein Gliedmaß nach dem nächsten zu verlieren. Der Verfall scheint nicht mehr aufzuhalten zu sein.
Dass Sarah Waters mehrere hundert, beinahe ereignislose, Seiten voranstellt, mag manchem Leser nicht gefallen, jedoch ist The Little Stranger stets außerordentlich fesselnd zu lesen. Der behäbige Handlungsaufbau ist eine lohnende Investition, denn sowohl die Ayres‘ als auch Hundreds Hall gewinnen eine derartige Dreidimensionalität, dass man als Leser emotional immer tiefer in das einsame, unaufhaltsam sterbende Herrenhaus gesogen wird und dem dunklen Schicksal der Ayres‘ mit wachsender Zuneigung folgt. Der unaufhörliche Stimmungsaufbau muss Sarah Waters sehr viel abverlangt haben, aber das lohnenswerte Ergebnis ist, dass man der Welt von Hundreds Hall so nah kommt wie nur wenigen imaginären literarischen Landschaften.
In die Erzählung des bis dahin schemenhaften und neutralen Dr. Faraday mischen sich jetzt zunehmend seltsame Begebenheiten und immer unheimlichere Ereignisse. Dr. Faraday, stets der Rationalist in Person, muss hilflos dem Fall des Hauses Ayres beiwohnen. Der schleichende Tod von Hundreds Hall greift jetzt auch nach den Familienmitgliedern. Obwohl den Ayres‘ längst klar ist, dass etwas Übernatürliches – „Der kleine Fremdling“ des Originaltitels – in den Mauern von Hundreds Hall zu angsteinflößender Größe anwächst, wird Dr. Faraday nicht müde, rationale Erklärungen zu suchen. Ausgerechnet der im menschlichen Umgang leicht primitive Kollege von Dr. Faraday, Dr. Seeley, kommt der Sache wohl am nächsten, wenn er Dr. Faraday die esoterisch klingende Erklärung verkaufen will, dass die unheimliche Präsenz in Hundreds Hall ein von einem lebenden Menschen abgespaltetes Schatten-Ich ist, entstanden aus einem dunklen Keim, „um zu wachsen wie, wie ein Kind im Mutterleib.“
The Little Strangerlässt seine Leser verwirrt zurück, denn das Ende wirft Fragen auf, die sich zunächst nicht ohne weiteres beantworten lassen. Wer sich aber darauf einlässt, kann sich mit dem Roman auch noch lange nach der Lektüre beschäftigen, denn die mögliche Lösung der Rätsel kann erst im Kopf des Lesers gefunden werden. Dabei stellt sich als wichtigste Frage: Was terrorisiert Hundreds Hall? Weitere grundlegende Detailfragen sind: Warum beginnt der Fall des Hauses Ayres erst, seit Dr. Faraday dort verkehrt? Warum geschieht niemals etwas Unheimliches, während Dr. Faraday in Hundreds Hall anwesend ist?
Sarah Waters hat mit der finsteren, übernatürlichen Tragödie The Little Stranger ihr reifstes Buch geschrieben. Im Gegensatz zum konstruiert wirkenden Vorgängerroman The Night Watch [Die Frauen von London] fließt The Little Stranger mit einer eigenen inneren Logik. Mit Caroline Ayres hat Waters ihre wohl nuancierteste und liebenswerteste weibliche Handlungsfigur geschaffen. Obwohl sie von Dr. Faraday immer wieder als hässlich dargestellt wird, lassen seine sachlichen Beschreibungen Carolines sie paradoxerweise als außerordentlich attraktiv vor dem inneren Auge des Lesers entstehen. Sie ist die wahre Feministin in Waters Gesamtwerk, ohne jemals darüber nachgedacht zu haben, was Feminismus ist. Sie rasiert sich nicht die Beine, stiefelt am liebsten mit ihrem Hund Gyp durch die Wälder, legt nicht den geringsten Wert auf standesgemäße Kleidung und weigert sich beharrlich zu heiraten. Und das ohne die geringste aggressive Attitüde. Es ist einfach ihre Natur.
Die übernatürlichen Eingriffe in die Handlung sind subtil und schaurig. Mit großem Respekt vor den Klassikern der unheimlichen Literatur bedient Sarah Water sich traditioneller Topoi wie „Poltergeist“ und „Rache aus dem Reich der Toten“ und gliedert diese in ihre großen Themen ein, als hätten sie schon immer dazugehört.
Sarah Waters hat einen großen, zu Herzen gehenden Gesellschaftsroman und einen gänsehauterzeugenden Horror-Roman geschrieben.
Deutsche Übersetzung: Der Besucher, übersetzt von Ute Leibmann (Köln: Lübbe Ehrenwirth, 2011)
Lektorat: Uwe Voehl