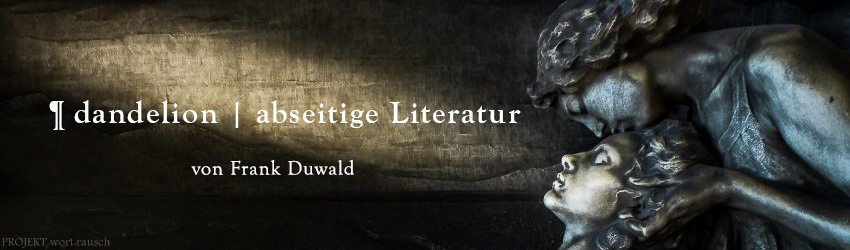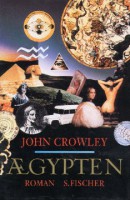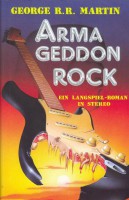Der wahre Sinn der Kunst liegt nicht darin, schöne Objekte zu schaffen.
Es ist vielmehr eine Methode, um zu verstehen. Ein Weg, die Welt zu durchdringen und den eigenen Platz zu finden.
Paul Auster
Kapitel 1
Vom Hoffen auf ein Leben
1
Wenn Frank seine Augen schloss, dann konnte er seinen Vater hinter der Theke stehen sehen. Die Hände abgestützt, immer mit Krawatte unter dem Kinn. Wässrig blau die Augen, wie windstille Meere. Oben im Flur hingen noch alle seine Krawatten im Kleiderschrank, als wären es herausgerissene glänzende Zungen. Bis heute hatte Frank keine davon tragen können.
Nach dem Krieg hatte sein Vater den Tabakladen hier in Giesing aufgemacht, zwischen den verwinkelten Straßen und den verwilderten Hinterhöfen. Damals hatte ja noch beinahe jeder geraucht. Natürlich auch sein Vater. Jeden Tag drei Schachteln Lucky Strikes ohne Filter. An manchen Schultagen konnte Frank seinen Vater unten lange husten hören, bevor die ersten Leute kamen, um die Zeitung zu kaufen. Später hatte er dann auch Lotterielose verkauft und Groschenhefte.
Frank blickte auf und sah durch das schmale Schaufenster nach draußen. Das Licht merkwürdig und die Schatten gebrochen. Seit zwei Tagen schneite es unaufhörlich, und Frank nickte. So soll es sein zur Weihnachtszeit, dachte er sich, zog eine Zigarette aus der Packung, zündete sie an und fühlte sich plötzlich alt und schwermütig. Und tatsächlich war Frank nun schon älter als sein Vater geworden war.
Draußen schlitterte ein Auto auf der rissigen Straße entlang, ein Mann mit Weihnachtspaketen unter dem Arm verschwand in einer Seitenstraße. Flackernd die Straßenlaternen, die ersten Sturmböen bogen die Äste der kranken Bäume zu Boden.
Es war ein 24. Dezember wie heute gewesen, als Franks Vater den Laden früher als gewohnt zusperrte. Ungewöhnlich früh sogar. Schneetreiben und Gespenster, die jeden Namen kannten. In den späten siebziger Jahren, als die letzten RAF-Spukgestalten noch in den Ecken lauerten, war sein Vater zur Donnersbergerbrücke gefahren, hatte sich auf das vereiste Geländer gestellt und solange gewartet, bis er die ersten Lichter eines Güterzuges sehen konnte. Dann war er einfach gesprungen. Zu Hause der Weihnachtsbaum in der Ecke, schief gewachsen wie ein schiefes Leben. Mit Kerzen, die noch niemand angezündet hatte.
Wir sind das, was das Leben aus uns macht, dachte sich Frank und nickte abermals. Überlegte einen Augenblick, ob er es laut ausgesprochen hatte. Aus dem Hinterzimmer mit dem Tisch und den Stühlen drang leise aus dem Grundig-Radiogerät Stille Nacht.
Einige Jahre lang war Frank jedes Weihnachten zu dieser Brücke gegangen und hatte gewartet, bis alle verschwunden waren. Hatte sich auf das Geländer gestellt und sich gefragt, wie es sei zu fliegen. Natürlich war er nie gesprungen, wenngleich sich jedes Jahr mehr etwas abschälte ihn ihm; das Unverständnis des Sterbens in einer eisigen Dezembernacht.
“Und wir wären gerne, was wir nie erreichen”, flüsterte Frank und strich sich schnell über den Mund. Inhalierte den Rauch und drückte die Zigarette zu früh aus. Nicht mehr allzu lange, und er würde seine wenigen Freunde durch den Schnee stapfen sehen. Schon von Weitem würde er sie erkennen können, an ihrem Wanken und Taumeln. Mit müden Knochen und müden Augen. Sie waren noch alles, was er hatte in dieser großen, dunklen Stadt. Außer Martha drüben vom Waschsalon, die er manchmal besuchte, wenn er heimlich ihr Parfüm riechen wollte, um sich lebendig zu fühlen. Martha, die mindestens genauso alt war wie er selbst und wegen ihres schlimmen Rückens Morphium-Tabletten nehmen musste, und die er oft vor dem Salon stehen sah, rauchend. Den Blick hilflos zum Himmel gerichtet.
Und natürlich außer Nellie. Aber Nellie war keine Freundin. Sie war vielmehr wie ein Herzschlag. Manchmal stolpernd, manchmal rasend. Schon seit Anfang November hatte Frank überlegt, ob er diesen Heiligen Abend tatsächlich von Nellie erzählen sollte und davon, dass niemand vergessen ist auf dieser Welt.
Martha schlüpfte aus der Waschsalontür und zündete sich hastig eine Zigarette an. Rauchte viel zu hastig. Auch ihr hatte er von Nellie erzählt, aber natürlich nicht die ganze Geschichte. Nichts davon, dass er sie tatsächlich manches Mal spüren konnte. Tief im Bauch.
“Wir hoffen auf ein Leben, das wir immerzu suchen. Und nur manchmal finden. In den Herzen anderer, du weißt”, hatte einmal Leibrand zu ihm gesagt, als die ersten Herbststürme die Wolken nach Osten getrieben hatten, lange bevor Frank von Nellie zum ersten Mal gehört hatte. Wie eine Vorahnung hatte er es damals gesagt, denn einige Monate später war Leibrand tot. Und er fehlte, dieser merkwürdige Mann, der vielleicht alles verstanden hätte. Leibrand hatte immerzu von Brooklyn geträumt, von seinem ganz eigenen Amerika. Mit den dunklen Wegen und den hellen geheimnisvollen Orten. Mit den Träumen und den Fragmenten, den Skizzen des Lebens.
Frank drehte sich um und blickte auf das Bild, das Leibrand gemalt und ihm dann geschenkt hatte. Amerika-Plakate. Zu Weihnachten vor hundert Jahren. Am gleichen Tag war Leibrand inmitten des Ladens umgefallen, als hätte ihn jemand einfach umgestoßen. Und Herr im Himmel, Frank konnte sich noch sehr genau an das Gefühl erinnern, als er ihn dort ohnmächtig liegen sah. Er hatte damals an seinen Vater denken müssen, der auf den Bahngleisen gelegen war, aus der Dunkelheit herabgefallen, wartend auf den letzten Atemhauch. Oft hatte sich Frank gefragt, ob Leibrand davon gewusst, oder vielleicht auch nur gespürt hatte. Und dass das Bild in seinem Kopf gewesen war, einen vom Güterzug zerrissenen Vater in einer mondlosen Weihnachtsnacht. Von den Träumen, dass er selbst an seinem Tod schuld sei und sonst niemand. Davon, dass er es hätte spüren müssen.
Aber als Leibrand da gelegen hatte, mit geschlossenen Augen und weit ausgestreckten Armen, war irgendwie jede Schuld von Frank genommen worden. Gib mir Zuversicht, gib mir Hoffnung und Schutz vor dem Sturm. Worte, die Frank damals in seinem Bauch gehört hatte.
Er hob seine Hand und winkte Martha, die ihn bemerkte und auch winkte. Im fahlen Licht der Straßenlampe glaubte er zu sehen, dass sie lächelte, und für einen Moment wollte er hinüber gehen und sie in den Arm schließen. Für alle Zeit, für immer und ewig.
Aber noch bevor er einen Schritt wagen konnte, war sie wieder im Waschsalon verschwunden, und der Schnee verdeckte ihre Spuren.
Von einem Herzschlag zum anderen.
Kapitel 2
Das Treffen der traurigen Leute
1
Das Hinterzimmer war aufgeräumter als gewohnt, auf dem schmalen Tisch leere Aschenbecher und elf Flaschen billiger Wein, den Frank im Supermarkt gekauft hatte. Durch das schmale schmutzige Fenster konnte er in hell beleuchtete Wohnungen sehen, erblickte hohe Weihnachtsbäume und Wartende. Dort ein trauriges Kind, das die Nase platt drücke am Fensterglas. Eigentlich hatte er auch einen Baum besorgen wollen, es dann aber doch wieder vergessen. Seufzend zündete er zwei Kerzen an, die er noch unter der Theke gefunden hatte. Für alle Fälle, falls doch mal wieder der Strom ausfallen würde. Rauschend das Radiogerät, aus der Ferne dumpfe Kirchenglocken. Später dann würde er Essen besorgen, von einem der Läden einige Straßen weiter, die immer geöffnet hatten. Wie leere Herzen.
In solchen Momenten fragte sich Frank besonders, weshalb er nie eine Frau gefunden hatte. Eine Frau wie Martha vielleicht, mit der er zusammen die Tage hätte verbringen können. Mit Weihnachtsbaum und Geschenken, mit guten Träumen und guten Augenblicken. Vielleicht deshalb, weil so gut wie nie Frauen in seinen Laden kamen, nicht einmal für die Lottoscheine. Und wo hätte er auch Frauen kennenlernen sollen? Manchmal schlief er nach acht Uhr abends hier im Laden ein und träumte von seinem verlorenen Leben, zwischen Wellengang und Mondfinsternis. Weit offen die Ladentüre. Krähen, die in seinen Schuhen schliefen.
Dabei hatte er früher vorgehabt, wegzugehen. Früher, weit vor Vaters Tod. Jeder Weg noch offen und hell beleuchtet, nichts verwinkelt und verborgen. Wenngleich er sich auch nur noch fahrig erinnern konnte, weshalb, waren die Gedanken daran warm und gütig. Letztendlich war er aber nie weiter gekommen als bis zu dem kleinen Laden mit der schiefen Tür, deren Schloss in den Wintermonaten zufror. Mit dem abgetretenen Linoleum und den nikotingelben Wänden. Mit der verlassenen Wohnung darüber, den tausend Zimmern und den tausend Gespenstern. Den Gerüchen einer anderen Zeit und den Schattenverwischungen von Kindheitstagen.
Eigentlich war Frank nie gerne in der Wohnung gewesen, hatte dort immer schlecht geträumt. Selbst wenn er nicht geschlafen hatte. Als würden die toten Ungeziefer unter den Tapeten mit ihm sprechen und von den Alpträumen des Lebens erzählen. Von der Einsamkeit, dunkelgraue Episoden. Vielleicht waren sie deshalb auch immer ein wenig länger geblieben, seine Freunde. Weil sie es gespürt hatten, zwischen zwei Zigarettenzügen.
Warum in aller Welt hatte er auch nie Martha gefragt, nie zu einem Kaffee eingeladen? Natürlich hatte er es immer wieder mal vorgehabt, es dann aber doch nicht getan.
“Frohe Weihnachten”, sagte plötzlich eine Stimme, und Frank erschrak.
“Herr im Himmel. Willst du, dass ich zu Weihnachten einen Herzinfarkt bekomme?”
“Der Herr ist dein Hirte”, sagte Abraham leise, hustete und lachte unbeholfen. Dabei rutschten seine falschen Zähne klackernd ein wenig nach vorne. Er schob sie wieder zurück. Abraham war schon in den Laden gekommen, als Franks Vater noch gelebt hatte. Jeden Tag zwei Päckchen Roth-Händle. Eine davon glomm zwischen seinen Fingern.
In vielen Leuten steckt ein wenig Leibrand, dachte sich Frank, als er Abraham ansah. Die Hose alt und schmutzig, der Mantel abgestoßen. Eingetrockneter Vogeldreck auf dem uralten Hut.
“Diese verfluchten Menschen”, sagte Abraham ohne Umschweife, als er sich setzte.
“Ja”, sagte Frank, goss ihm Wein in ein Glas.
“Ausgelacht haben sie mich. Stell dir das mal vor. Nur weil ich mit den Mäusen geredet habe. Als ich noch die Straßen gekehrt habe, habe ich immer mit den Mäusen geredet. Mit den Menschen kann man ja nicht reden. Kommt ja doch nur Unsinn dabei raus.”

“Trink ein wenig”, sagte Frank und füllte erneut Wein in das Glas.
Wir brauchen traurige Menschen. Auch das dachte sich Frank gerade. Denn alleine in der Traurigkeit steckte jene Hoffnung, die das Leben offenbarte.
“Alles wird gut”, flüsterte Frank, obwohl er selbst nicht mehr so recht daran glaubte. Manchmal sah er Abraham durch die Straßen gehen, wankend als wäre er betrunken. Aber es war nicht der Schnaps, der seine Schritte unsicher machte, sondern alleine das verzweifelte Leben. Von Ost nach West, wenn man nicht weiß, wer oder was man ist. Lieder von Kurt Weill brummend, manchmal den Blick ungläubig zum Himmel gerichtet. Fünfzig Jahre lang die Straßen der Stadt gekehrt, so hatte Abraham immer mehr verloren und zum Schluss sich selbst. Wie eine Uhr oder ein Portemonnaie, für alle Zeit verloren.
Der alte Mann schniefte und wischte sich die Nase mit dem Mantelärmel sauber, hustete lange.
“Weine wie ein kleines Kind. Sollte mich was schämen. Und das zu Weihnachten.” Die falschen Zähne klackten laut aufeinander.
Vielleicht sollten sich ganz andere Leute schämen, dachte sich Frank, aber sprach es nicht aus, sondern strich stattdessen über Abrahams Kopf. Vor vier, fünf Jahren war Abrahams Frau an einem Schlaganfall gestorben, daran konnte sich Frank noch gut erinnern. Sie hatte tot im Bett neben Abraham gelegen. Auch daran, dass er danach versucht hatte, sich einfach tot zu rauchen. Sieben Schachteln Zigaretten am Tag, aber außer einer schweren Bronchitis war überhaupt nichts geschehen.
Draußen ratterte die Straßenbahn vorbei, Funken stoben empor. Ein Mann mit Hund auf dem Schoß saß im hinteren Abteil und schlief. Seine Träume waren hell und dunkel zugleich.
Während der Hund über das Gesicht des Schlafenden leckte, als wolle er ihn aus einem hundertjährigen Traum erwecken, begann es bereits heftiger zu schneien.
2
Eine halbe Stunde später waren sie alle angekommen. Zuletzt Paul, dem sie vor einem Jahr das Bein amputiert hatten, und der deshalb immer viel zu spät kam. Und weil er oft Schmerzen hatte, vor allem an den kalten Tagen, saß Paul dicht neben dem knackenden Gasofen in dem abgewetzten Stuhl, den Frank auf dem Sperrmüll gefunden hatte, und rieb sich die Hände.
Dann waren da noch Bloch und Blumenstein. Und natürlich Anna, die ja gar nicht selbst rauchte. Ihr Mann hatte geraucht, wie ein Schlot sogar. Frank konnte sich nur fahrig an ihren Mann erinnern, denn er war bereits seit über zwanzig Jahren tot. Dennoch kam Anna einmal in der Woche in den Tabakladen, um Zigaretten für ihren Mann zu kaufen. Immer eine Stange Camel und zwei Lotterie-Lose. Eines für sich, eines für ihren Mann. Der nie viel von Lotterie-Losen gehalten hatte.
Immer schon hatte Frank sie danach fragen wollen, was sie mit den Zigaretten-Stangen machte, aber jedes Mal kam ihm die Frage falsch vor. Als würde er danach fragen, weshalb die Leute auf den Friedhof gingen, wenn sie ja doch mit niemanden sprechen konnten.
“Soll ich das Fenster aufmachen, Anna? Frische Luft?” fragte Frank und schaltete die Kaffeemaschine ein. Später würden sie reichlich davon brauchen können, weit nach Mitternacht.
“Dann hole ich mir womöglich den Tod”, sagte Anna, schüttelte den Kopf und trank Schnaps aus einem Flachmann. Sie prostete dem lieben Gott zu, weil der liebe Gott manchmal mit ihr einen trank. Am Stehausschank, im Hautbahnhof.
Bloch zündete die Zigarette von Blumenstein an, und Blumenstein die Zigarette von Bloch. Rauchkringel stiegen zur Decke empor, Bloch kicherte.
“Also? Wer hat einen neuen Roman?” fragte Paul leise, nippte am billigen Wein und rieb seinen Beinstumpf.
Frank setzte sich neben Anna und fragte sich, wie das alles nur hatte passieren können. Wie all die Geschichten in ihre Köpfe gekommen waren. Zuerst in den Bauch und dann in ihre Köpfe. Obwohl er es ahnte, vielleicht sogar wusste. Gib den traurigen Menschen eine Geschichte, damit sie nicht umsonst weinen. Hatte das nicht Leibrand gesagt, oder hatte sich das Frank nur eingebildet. Auf jeden Fall hätte es Leibrand sagen können, soviel stand fest.
Ja, gib den traurigen Menschen eine Geschichte.
Und Beine zum Tanzen.
Von Ost nach West, taumelnd.
Bis der Schnee aufhört
vom Himmel zu fallen.
Frank selbst hatte sich vor Leibrand nie für Geschichten interessiert, hatte kaum Bücher gelesen. Aber dann war dieser merkwürdige Leibrand in seinen Laden gekommen, und alles war danach anders gewesen. Als hätte dieser Leibrand all die Geschichten in sie hineingeträumt. Im Hinterzimmer rauchend Bloch und Blumenstein, Anna mit ihrem Flachmann und Paul noch mit zwei Beinen. Die allesamt den Tag nicht mochten und deshalb warteten, bis der Abend kommen würde. Und mit dem Abend die Dämmerung, in deren Schattengeäst man sich auf den Weg nach Hause machen konnte. Zu den hungrigen Traumgestalten, die von einem Leben erzählten, das nie erreicht wurde.
“Ich habe zwei neue Romane und sieben Kurzgeschichten”, sagte Bloch und rieb sich die Nase. Früher einmal war er Lokführer gewesen, ein halbes Leben lang. Heute, mit weit über sechzig Jahren, saß er in einer der billigen Dachwohnungen am Ausläufer der Stadt, mit dem Rattengetrippel im Gebälk. Gerade noch Geld genug, um sich Zigaretten zu kaufen und billigen Schnaps. Denn wenn nichts mehr bleibt, dann folgt man den Rauchschwaden zum Himmel. Aus Alkohol, der fast schon blind macht, gemalt die Flügel, um die Wolken zu erreichen.
“Drei Mäuse-Bücher, jawohl. Drei Mäuse-Bücher”. Abraham schniefte, zog aus seiner Hose ein altes Taschentuch und schnäuzte laut.

“Dafür habe ich sieben Romane geschrieben”, sagte Blumenstein, und Bloch kicherte abermals, weil er Blumenstein sehr bewunderte. Blumenstein schrieb Bücher, die so eigenartig waren, dass man sie kaum lesen konnte und doch lesen musste, sobald man damit angefangen hatte.
“Um Himmels willen, sieben Romane?” fragte Bloch und ließ dabei Asche auf den Boden fallen.
“Eigentlich wären es mehr geworden, hab mir aber Zeit gelassen. Truman Capote hat es auch so gemacht, hab ich mal gelesen. Hat sich auch Zeit gelassen.”
“Natürlich. Salinger ja auch.”, sagte Bloch und hustete heiser. Vermutlich hätte er auch sieben Romane, wenn nicht sogar mehr, geschafft. Aber in den Sommermonaten war er obdachlos gewesen, weil er seine Arbeit als Hausmeister verloren hatte. Gott sei Dank hatte ihm sein Freund Harvey einen Job als Aushilfsbriefträger beschafft und sogar eine neue Schreibmaschine geschenkt.
“Hat jemand was verkauft?” fragte Anna und trank einen weiteren Schluck Schnaps. Anna schrieb jeden Tag ein neues Gedicht für ihren toten Mann, das wussten sie alle.
“Was für ein Witz”, lachte Blumenstein, zündete sich am Zigarettenstummel eine frische Zigarette an und zog seine Mütze vom Kopf. Abraham weinte wieder ein wenig.
“Ich hab eine Geschichte eingetauscht gegen warme Socken. Halten bei mir ja länger, die Socken”, sagte Paul und legte das hoch genähte Hosenbein über das Knie.
“Ist eine schlechte Zeit für merkwürdige Bücher. Das denke ich mir oft”, sagte Anna ohne aufzusehen. Sie blickte häufig zu Boden. Oder hinauf zum Himmel.
Frank zündete sich eine Zigarette an und dachte nach. Wann das alles begonnen hatte. Früher schon hatten sie sich am Weihnachtsabend hier getroffen. Getrunken und geraucht und von den Dingen erzählt, die weder wahr noch gelogen waren. Vielmehr einer eigenen, tieferen Wahrheit inne. Eigentlich nur, um nicht alleine zu sein, während hinter all den anderen Fenstern sich Menschen umarmten und miteinander glücklich waren. Aber nachdem Leibrand gefallen war, hatte sich alles irgendwie verändert. Nicht sofort, vielmehr langsam, zögerlich. Bis an einem Weihnachtsabend vor vielen Jahren Blumenberg gesagt hatte: “Ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe einen Roman geschrieben. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist so. Soll ich etwas vorlesen?”
Was war danach geschehen? Frank versuchte sich zu erinnern, aber die Bilder waren verschwommen. Unklar. Nur so viel wusste er heute noch: Aus ihnen allen war mehr geworden, als sie jemals gewesen waren. Jedes Wort aus Blumenbergs Mund hatte den Himmel näher gebracht. Hatte den alten Schmutz von den Wänden des Hinterzimmers verschwinden und das Licht der Neonröhre glänzen lassen. Aus den Hoffnungslosen waren traurige Leute geworden. Von einem Atemzug zum anderen.
“Ein Schneesturm. Da. Gut, dass wir einen Platz haben”, sagte Bloch in die Stille hinein und Anna nickte, ohne hinauszusehen.
Fahl das Licht der Straßenlampen, gebrochene Schatten auf dem Weiß der Straßen. Ein zitternder Hund, der kurz vor dem Laden stehen blieb und nach den wilden Flocken schnappte, bevor er im Schneetreiben verschwand.
“Wer will heute eine Geschichte erzählen?” fragte Paul und schloss seine Augen.
“Ich denke, es ist Zeit, euch von Nellie zu erzählen. Ja, das denke ich”, flüsterte Frank, zündete sich eine Zigarette an, blies den ersten Rauch zur Decke empor und begann mit ein wenig Zittern ums Herz herum mit seiner Geschichte.
Während sich Kinder hinter Weihnachtsbäumen versteckten.
Während sich zwei Liebende auf der Straßenseite gegenüber fest umschlangen, um nicht hinzufallen.
Und natürlich während der Wolfsmann in den Hinterhöfen lauerte, weil jemand zu viel an das Sterben dachte und nicht an das Leben.
Kapitel 3
Nellie
1
Es fing an, nachdem Leibrand aus dem Fenster gefallen war. Damals, aus dem Fenster des Krankenhauses, inmitten einer Winternacht. Die Lungen voller Krebs, der Kopf voller Träume.
Jeder Mensch fehlt. Und Leibrand fehlte Frank sehr. Vielleicht gerade deshalb, weil er ihn nicht besonders gut gekannt, sondern vielmehr gefühlt hatte.
Einige Wochen nach Neujahr, als es noch einmal so richtig geschneit hatte, war er schließlich hinunter gegangen zu jenem Krankenhaus mit den großen Fenstern und den schiefen Dächern. Obwohl er nicht gewusst hatte, was er dort suchte. Oder gar finden wollte. Mit den Gesprächen und den eigenen kleinen Wahrheiten, die man hören konnte, hatte es begonnen. Vor dem Krankenhaus, bei den Wartenden und den stillen Hoffnungslosen. Die mit Zigaretten zwischen den Fingern schlaflos die Kälte nicht mehr spürten. Auch Obdachlose, die sich zu ihnen gesellten wie streunende Katzen und über die eigenen Krankheiten jammerten. Von offenen Beinen und offenen Seelen. Von kaputten Herzen, die kein Katheter mehr reparieren konnte. Nicht einmal der beste Chirurg der Welt.
So war Frank im ersten Jahr dort draußen im Schein der fahlen Außenbeleuchtung dem sterbenden Beckett begegnet, der nie schlafen konnte wegen der schlechten Matratzen und den schlechten Träumen. Dem er schon am zweiten Tag Zigaretten mitgebracht hatte, weil er Stummel rauchte, die er in seinen Hosentaschen versteckt hatte, aus Angst vor den Schwestern. Lange Stunden bevor Frank den Tabakladen aufsperrte, suchte er diesen Ort auf, der eigentlich so hässlich war wie kein anderer, und doch auf eine magische Art und Weise schön.
“Es gibt überall Menschen, die tatsächlich unsichtbar sind. Wir haben sie unsichtbar gemacht”, hatte Beckett plötzlich gesagt und auf all die Rauchenden gezeigt. Dabei die Hose hochgezogen, die an ausgeleierten Trägern hing.
“Aber glaub ja nicht, dass sie nicht alle ein Geheimnis haben. Ein Geheimnis, dass es wert ist, daran zu glauben. Ja?”
Frank hatte genickt, wenngleich er es nicht verstanden hatte.
“Wir liegen alle da drinnen in den Betten und erfahren Dinge, die wir nicht wissen wollen. Dass wir sterben oder eigentlich schon tot sind. Und dann geschieht etwas. Soll ich es dir verraten?” hatte Beckett gefragt und Frank hatte genickt. Während der Schnee gefallen war und ihre Fußspuren überdeckt hatte, als wären sie niemals hier gewesen.
“Dann denkt man plötzlich an Dinge, die man längst vergessen hat. Keine großen Sachen.”
“An was hast du gedacht?” hatte Frank gefragt und zu Beckett geblickt.
“Ich? Ich dachte an meinen Elefanten. Auf einem Elefanten zu reiten. Das wollte ich immer schon. Als Kind war das mein guter Gedanke beim Einschlafen, das Gute-Nacht-Gebet. Auf einem riesigen Elefanten zu sitzen, um den Himmel anzufassen. Das funktioniert nur auf einem Elefanten, glaube es mir. Das habe ich wohl verpasst.”
Dann hatte Beckett gelacht, mit schiefen Zähnen und asthmatischen Atemzügen. Drei Tage später war Beckett gestorben. Herzstillstand, mitten in der Nacht, wie Frank von einem anderen Patienten erfahren hatte.
Dieses erste Geheimnis der unsichtbaren Menschen ließ Frank nicht mehr los, und lange Zeit wusste er nicht so recht, was er tun sollte. Der Winter ging und auch der Frühling. Mit der Schneeschmelze veränderten sich die Menschen vor dem Krankenhaus, und Frank ging nicht mehr dorthin, weil sie stumm wurden und auf den Sommer hofften. Und auf ein neues Leben.
Aber trotzdem dachte er jeden Tag an Beckett und seinen geträumten Elefanten, fragte sich, wie es wohl sei mit Wünschen, die nie in Erfüllung gingen. Nicht einmal über den Tod hinaus. Aber dann geschah an einem Augusttag etwas Merkwürdiges. Eine Parade zog plötzlich die Straße entlang, er konnte sie schon von Weitem hören. Das Geklapper und den Marktschreier, das Wiehern und die verbeulten Trompeten. Die Tür des Ladens weit offen, rannte Frank hinaus und sah einen traurigen Aufmarsch. Erschöpfte Pferde und zwei Clowns mit schiefen Nasen, ein dickbäuchiger Dompteur mit staubigem Zylinder auf dem Kopf. Ein kläffender Pudel, zwei längst müde gewordene Kamele. Die betrunkene Schönheit auf dem Zirkuswagen rief: “Nur heute in der Stadt, nur heute in der Stadt. Die pure Magie!” Seifenblasen, die zum Himmel stiegen und zu schnell zerplatzten. Aber auch ein Elefant, der mindestens schon zweihundert Jahre alt war und immer stehen blieb, als wolle er es nicht glauben, wohin die Reise geführt hatte.
Frank dachte nicht allzu lange nach, holte alles Geld aus der Kasse und lief der betrunkenen Schönheit nach. Durch Konfetti-Wolken und den schiefen Tönen des Trauermarsches, bezahlte ein Vermögen und fiel zweimal herunter, bevor Frank laut lachte und leise weinte.
Und ritt auf dem Elefanten, um den Himmel anzufassen. Nur einen Augenblick, aber lange genug, um herauszufinden, dass es gelingen konnte.
Und er dachte an Beckett mit den schiefen Zähnen.
Und er dachte an Leibrand.
Und schließlich an alle, die er längst vergessen hatte.

2
“Du bist auf einem Elefanten geritten?” fragte Abraham und öffnete eine weitere Flasche Wein. Dichte Rauchschwaden hingen nahe der Zimmerdecke, und der Gasofen tuckerte leise. Die Lucky-Strikes-Neonwerbung im Laden flackerte und surrte.
“Ja, das bin ich tatsächlich. Zwar kein riesiger Elefant, aber immerhin. Ich denke, Beckett hätte es gefallen.”
“Ich bin mir sicher, dass es ihm gefallen hätte”, sagte Anna und klopfte an Franks Schulter. Sie trank den Flachmann leer und seufzte, weil sie zuviel getrunken hatte. Ihrem Mann gefiel gar nicht, wenn sie zuviel trank.
“Also ich hätte mich das nicht getraut”, sagte Bloch, und Blumenstein nickte.
“Frank ist ein mutiger Mann. Ja, das bist du”, sagte Anna und lächelte. Ihre Augen wässrig und hell. Sie strich über Franks Wangen, und er roch ihren Atem und den Schnaps. Roch ihr nahes Sterben.
“Aber du wolltest von Nellie erzählen, nicht wahr?” Bloch stand auf, ging in den Laden und holte sich aus dem großen Glas ein Briefchen Gratis-Streichhölzer. Eigentlich hatte Frank noch die Weihnachtsgirlanden aufhängen wollen, aber es genauso vergessen wie den Baum. Er sah nach draußen und betrachtete die Welt, die still geworden war. Still und langsam. Hell erleuchtet die Fenster, einzig und alleine ein Zeitungsverkäufer, der sich verlaufen hatte.
“Ja, Nellie. Natürlich, Nellie.”
Und so erzählte er weiter.
3
Zwei Winter später begegnete Frank um vier Uhr morgens vor dem Krankenhaus Jonas aus dem Walfischbauch. Jedenfalls nannte sich der Mann so. Jener Mann mit dem riesigen Bauch und dem schmalen Gesicht, den wenigen Haaren auf dem Kopf und den zittrigen Händen.
“Mich hat der Wal zu spät ausgespuckt. Zu spät, zu spät, zu spät!”
“Ja?” Frank gab ihm eine Zigarette. Jonas versuchte sie anzuzünden, was ihm nicht gelang. Er fluchte leise.
“Manchmal ist es zu spät. So ist das Leben. Manchmal hat man Glück, und manchmal entwischt einem das Glück. Hier.” Jonas aus dem Walfischbauch zog aus seiner schmutzigen Jacke eine Fotografie. Frank sah sich das Bild an, eine junge Frau mit dunklen langen Haaren und einer kleinen Narbe auf der Stirn. Die junge Frau lächelte.

“Das ist Nellie. Meine Nellie.”
“Was ist passiert? Wegen der Narbe?” Frank hatte gar nicht fragen wollen, aber doch waren ihm die Worte entwischt, als er die Fotografie in die Hände nahm.
“Mit sieben Jahren ist sie vom Kirschbaum im Garten gefallen. Sie wollte hinauf, um die Wolken anzufassen. Was hat sie geschrien. Und was hatten wir Angst um sie. Angst um Kinder ist das Schlimmste, was es gibt.”
“Sie hat es überstanden”, flüsterte Frank und lächelte. Weiße Atemwolken über ihren Köpfen.
“Drei Jahre später ist ihre Mutter gestorben. Meine Frau. Ein Unfall, ich bin gefahren. Sie war nüchtern, weil sie nie etwas getrunken hat. Ich war nicht nüchtern, natürlich nicht. Ich weiß bis heute nicht ganz genau, was passiert ist. Als ich aufgewacht bin, lag sie da im Maisfeld. Neben dem Auto. Ihre Augen ganz weit offen und die Haare ganz voller Blut, als hätte sie sich heimlich die Haare gefärbt. Ganz schief der Kopf. Mein Gott, so hässlich schief. Außer blauen Flecken ist mir damals gar nichts passiert. Aber dann schon. Dann kam der Wal und verschluckte mich. Ganz tief hinein in den stinkenden Bauch mit den klirrenden Flaschen. Immer nur Schnaps, den ganzen Tag. Und Matrosenlieder, ganz leise. Piraten, die auf dem Wal getanzt haben.”
“Was ist mit Nellie geschehen?”
“Ich weiß es nicht”, sagte Jonas und schüttelte den Kopf. Zog an der Zigarette, hustete, wischte sich über den Mund. Frank sah hinunter und sah den Katheter-Beutel an seiner Hose hängen.
“Du weißt es nicht?” Frank schlug den Mantelkragen hoch und wischte sich den Schnee vom Gesicht.
“Sie ist verschwunden. Das Amt hat sie abgeholt, und sie ist einfach verschwunden. Das ist alles, was ich weiß. Nellie. Weiß ja nicht einmal, wie lange das nun alles schon her ist. Hat es bestimmt besser gehabt, sonst hätte sie vielleicht auch der Wal verschluckt.”
“Ja, vielleicht.”
“Im Walfischbauch sind auch die Ungeheuer. Die eigenen. Im Schatten warten sie auf einen. Warten solange, bis man schläft. Hast du noch eine Zigarette?”

Frank gab ihm das angerissene Päckchen, und Jonas nickte. Frank fragte sich, wie lange der Mann noch zu Leben hatte. Wie viele Atemzüge noch in ihm waren, und was ein Leben überhaupt war. Einige Straßen weiter hörten sie einen Krankenwagen die Stille des frühen Morgens durchbrechen. Jemand lachte, jemand hustete. Zwei Männer in dreckigen Morgenmänteln und nassen Schuhen schüttelten den frischen Schnee von dem Weihnachtsbaum neben der Krankenhaustür, weil sie nichts Besseres zu tun hatten.
“Und dann, vor ein paar Tagen kam ein Brief von Nellie. Mit dem Bild. Weihnachten macht die Menschen anders, das glaube ich. Vielleicht hat sie wieder einmal an mich gedacht. Einfach so. An ihren kaputten Vater.” Er lachte, die Zigarette fiel aus seinem Mund in den Schnee, ohne dass er es bemerkte.
“Sie will mich besuchen, hat sie geschrieben. Und ob es mir gut geht. Und dass wir vielleicht Silvester zusammen verbringen könnten. Ja, das hat sie geschrieben. Kann man sich das vorstellen? Auf ein ganz neues Jahr.”
Der Krankenwagen schlitterte die Auffahrt hoch und kam zum Stehen. Türen wurden aufgerissen, die zwei Männer in den Morgenmänteln verschwanden im Tumult. Aus dem Krankenhaus lief ein Arzt, der seinen Schuh verloren hatte. Das Maul des Krankenwagens öffnete sich. Auf der Liege ein Junge mit tausend Schläuchen und schneeweißer Haut. Jemand schrie laut.
Der Junge ist keine zehn Jahre alt und der Junge ist tot, dachte sich Frank und fror plötzlich, ganz tief drinnen.
Menschen über dem Jungen. Beatmungsbeutel, das Zischen des Sauerstoffes. Blut, das in eine Infusionsflasche zurücklief. Die Liege, die zu Boden krachte und zitternde Hände, die auf den Brustkorb des Jungen drückten. Immer und immer wieder. Spritzen, Ampullen und noch mehr Schläuche. Zersplittertes Glas am Boden. Atemwolken über allen Gesichtern, aus allen Mündern. Nur nicht aus dem Mund des Jungen, der mit offenen Augen zum Himmel starrte, als würde er alles sehen können.
“Jonas?” Frank sah sich um, doch Jonas war verschwunden.
Alles verlangsamte sich, jede Bewegung. Jeder Schneefall. Und schließlich hörte alles auf, wie das Leben des Jungen.
4
“Hast du ihn je wiedergesehen? Jonas aus dem Walfischbauch?” fragte Bloch und holte sich als Erster eine Tasse Kaffee. Frank sah hoch zur Uhr, die über der Tür hing. Nicht mehr lange und es würde Mitternacht sein. Er schüttelte den Kopf.
“Aber du hast nach ihm gesucht, so ist es doch?” fragte Abraham und knüllte das leere Zigaretten-Päckchen zusammen. Schob es in seine Hosentasche.
“Ich ging die nächsten Tage zum Krankenhaus, ja. Habe auf ihn gewartet. Eine Weile habe ich mir überlegt, nach ihm zu fragen. Aber das kam mir irgendwie falsch vor.”
“Weil er vielleicht wieder in dem Walfischbauch ist” sagte Anna und holte sich auch einen Kaffee. Suchte Milch und Zucker, fand aber beides nicht. Am Türrahmen blieb sie kurz stehen und betrachtete die Welt da draußen. Mit den Schneeverwehungen und den Windböen. Mit den Hoffnungen und den Traurigkeiten, die zum Himmel stoben.
“Ja. Weil ihn vielleicht der Wal dieses Mal ganz gefressen hat. Oder die Ungeheuer in dem Wal, wer weiß das schon”, sagte Frank und lächelte unbeholfen. Ein Streichholz flammte auf.
5
Jonas war verschwunden und verschluckt. Alles, was Frank geblieben war, waren seine Worte und die Fotografie von Nellie. Der schönen jungen Frau mit der Narbe auf der Stirn. Die Nächte durchzogen von eigenartigen blauen Träumen, dass etwas nicht erfüllt worden war; eine Hoffnung. Warum hatte der eigenartige kranke Mann das Bild nicht wieder an sich genommen? Frank dachte lange Zeit darüber nach, immer wieder. Vielleicht, weil man im Angesicht des Sterbens manchmal bis auf den Grund einer Seele sehen kann und er Frank vertraut hatte, das Richtige zu tun.
Und vielleicht lag es an der früheren Begegnung mit Leibrand, dass Frank sich entschloss, sich tatsächlich auf die Suche zu machen. Das Leben zu verändern, die dunklen Wege auszuleuchten. Endlich.
Wir alle hoffen auf ein gutes Leben, dachte sich Frank, und so war es auch. In seinen losen Träumen stellte sich Frank vor, dass Nellie sich ebenso auf die Suche machte. Nach dem Walfisch und den Gesängen, nach ihrem Vater und seinen Geschichten, die sie nie gehört hatte. Und dann hatte Frank schließlich doch noch eine Idee, die gut genug war, um ein Schicksal zu wenden.
Zwei Tage vor Silvester wurde Frank irgendwie zu Jonas aus dem Walfischbauch. Es geschah plötzlich, von einem Augenblick zum anderen. Er ging nach oben und zog sich einen Mantel seines Vaters an, der ihm viel zu groß war. Dann noch eine seiner Mützen, die er manchmal aufgezogen hatte als Kind, um sich erwachsen zu fühlen. Und er fühlte sich anders.
“Wir sind das, für was wir uns halten”, sagte er zu sich und ging die Straße hinunter zu dem Fotografen, der manchmal in den Tabakladen kam, um sich frische Zigarillos zu kaufen. Siebenundvierzig Abzüge der Fotografie wie siebenundvierzig Herzschläge, tief versteckt. Fürs Erste eine gute Zahl. Wankte davon und lauschte den Piratengesängen aus den Hinterhöfen, die man tatsächlich hören konnte, wenn man mit den richtigen Ohren zuhörte. Verschwand in Bars und dunklen Wirtstuben. Erzählte von einem guten Leben und wunderschönen Geschichten. Von der großen Sehnsucht nach einer Tochter. Nach Nellie.
“Ich kann ihnen erzählen, woher die Narbe kommt”. So fing Frank meistens an, und dann erzählte er von dem Kirschbaum und verwebte das geheime Leben von Jonas aus dem Walfischbauch mit der Wahrheit. Phrasierte von seinen unglaublichen Reisen, von seinen Erlebnissen in Brooklyn, Paris und Alaska. Dort überall hatte er Nellie gesucht, natürlich, und sie immer wieder verpasst. Hatte sie jeden Herzschlag lang vermisst. Träumte sich das Leben des fremden kranken Mannes auf dem Krankenhausvorplatz zurecht. Der Liebe wegen. Weit über den Tod hinaus.
Erzählte von den vielen Briefen, die er nie abgeschickt hatte, weil kein Wort das alles erklären hätte können. Von den vielen Büchern, die er für seine Tochter geschrieben hatte. Geschichten über Mäuse. Geschichten, die so schön waren, dass man sie lesen musste. Auch Gedichte, natürlich auch Gedichte. Nur für Nellie, ein ganzes Leben lang nur für Nellie. Die nicht da gewesen war und er nicht bei ihr.
So lange, bis Frank die Walfischgesänge hören konnte und er an seinen Vater denken musste, der bestimmt auch ein anderes Leben hinter dem eigentlichen Leben gehabt hatte. Eines, das nie erreicht worden war, so sehr sich sein Vater auch angestrengt hatte. Musste an den Jungen denken, der aus dem Maul des Krankenwagens gefallen war und zu einem Engel wurde, noch bevor er sich zum ersten Mal in seinem Leben hatte verlieben können.
Und so geschah es, dass Nellies Bild in Bars hing, in den kleinen Läden der Seitenstraßen, in Wirtstuben, in zahlreichen Buchläden und in U-Bahnhöfen. Sogar in zwei Kirchen, gleich neben Jesus Christus. Allein nur, weil die Menschen so angetan waren, von der Liebe und dem Begehren, dem Unausgesprochenen eine Stimme zu geben. Der Vermissten ein Gesicht zu geben und dem Suchenden eine Geschichte.
Eines Tages würde Nellie sicher an den richtigen Ort kommen und jemand würde sich an die Gespräche erinnern. Würde erzählen von dem Mann in einem viel zu großen Mantel und einer albernen Mütze, der sie gesucht hatte. Von ihr gesprochen hatte.
“Ja, Jonas hat der fremde Mann geheißen. Jetzt wo Sie es sagen. Die Narbe. Sie sind von einem Kirschbaum gefallen, nicht wahr?”, würde dieser Jemand sagen und dann beginnen zu berichten. Von dem geheimen Leben und den Träumen. Nellie würde vielleicht glücklich sein können, entschwindend das Bild ihres betrunkenen, nutzlosen Vaters. Weil in jedem Menschen etwas steckt, das wir nicht zu sehen vermögen. Tief im Bauch verborgen, wie einst Jonas im Walfischbauch.
Jemand wartet auf dich.
Vielleicht sogar ein Leben lang,
nie erfüllter Kuss.
Herr, sei uns gnädig,
damit wir nicht vergessen sind.
Schick uns einen Traum,
so himmelblau wie der Himmel
in einer guten Zeit.
Kapitel 4
Im Schneesturm tanzen die Gespenster
1
“Du verteilst die Fotografien immer noch, habe ich recht? Und mit dem Bild die Geschichten, die von ihr handeln”, fragte Blumenstein, schaltete die Kaffeemaschine aus und goss sich den bitter gewordenen Rest in ein Glas. Dean Martin sang von Wintertagen aus dem Radiogerät.
Frank nickte. “Ja, immer an den letzten Tagen des Jahres. Ich bin es ihm schuldig, irgendwie. Und Nellie auch.”
“Hast du sie jemals gesehen?” Paul zog aus seiner Hosentasche einige Schmerztabletten, legte sie auf die Zunge und schluckte sie hinunter.
“Das ist eine merkwürdige Sache, müsst ihr wissen. Manchmal nämlich glaube ich sie zu sehen. Oder möchte ich es glauben. Damit nichts umsonst ist. Manchmal sehe ich Nellie die Straße hinunter gehen oder auf den nächsten Bus warten. Ich schwöre, sie könnte es sein. Mit der Narbe auf der Stirn und den wunderschönen Haaren. Und sie lächelt. Lächelt so, als hätte sie gerade etwas Wundervolles gehört. Etwas, das sie vermisst hatte. Jedenfalls wünsche ich es mir, dass es so sei. Vielleicht ist es auch gar nicht Nellie, die ich sehe.”
“Aber vielleicht ist sie es doch”, sagte Anna, lächelte und dachte an ihren Mann. Den sie ja in manchen Nächten hören konnte. Draußen in der kleinen kalten Küche. Wenn er sich einen späten Kaffee kochte, weil er nicht schlafen konnte.
“Ja, vielleicht”, flüsterte Frank und dachte an den Stapel der Fotografien, die im Laden in einem Karton neben den Zigarettenstangen lagen.
“Vielleicht hat das alles Leibrand gewusst. Und wir schreiben deshalb Geschichten, die niemand verstehen kann. Außer wir. Und vielleicht außer Nellie. Das würde ich ihm zutrauen.” Abraham strich den Aschenbecher glatt und blickte in das leere Glas und sah ein Meer mit Möwen am Himmel. Dieses Mal weinte er nicht.
“Und das wäre doch schön”, sagte Bloch, lächelte.
“Ja. Nellie. Was für ein wunderbarer Name. Erzählst du uns von ihr? Nicht über sie, sondern von ihr? Du weißt doch alles” fragte Blumenstein, der sein altes Notizbuch herausgezogen hatte.
“Wir haben immer für sie geschrieben, nicht wahr? Für immer und vielleicht für alle Zeit”, flüsterte Paul und dachte an Leibrand. Der immer für das Leben und die Liebe gefallen war.
“Ich kann ja auch mal Gedichte nur für Nellie schreiben. Das würde mein Mann verstehen.”
2
Frank drehte sich noch einmal um, als er die Ladentüre schloss, um sich auf den Weg zu dem chinesischen Imbiss zu machen. Es war weit nach Mitternacht und die einzige Möglichkeit noch etwas zu Essen zu bekommen. In seinen Hosentaschen zählte er die Münzen und schlug den Kragen seiner Jacke hoch. Ganz leise konnte er die Stimmen seiner Freunde noch hören, so leise wie das Walfischsingen aus den fernen Straßen. Eiskalt die Luft, atmete er sie tief ein. Der Schneesturm hatte nachgelassen, die letzte Straßenbahn kroch langsam über die Kreuzung. Windböen bliesen Schneegestalten nach Osten. Losgerissene Weihnachtsgirlanden lagen wie schlafende Schlangen auf der Straße.
Sie würden zusammen essen, frischen Kaffee brühen und vielleicht würde er etwas von Nellie erzählen. Etwas Erträumtes, helle Episoden. Plötzlich glaubte Frank seinen Namen gehört zu haben, ganz leise, aber er hatte sich getäuscht. Blickte trotzdem hinüber zu dem Waschsalon, bei dem auch immer noch Licht brannte. Martha, die vielleicht wegen der Morphium-Tabletten eingeschlafen war. Aber dann öffnete sich die Tür, und er sah Martha. Noch bevor er nachdenken konnte, überquerte er die Straße, schlitterte über die Schneeverwehungen und fiel beinahe hin. Kaum in ihrer Nähe, roch er ihr Parfüm, und er musste lächeln.
“Frohe Weihnachten, Martha.” Den Lippenstift zittrig aufgetragen, lächelte auch sie.
“Frohe Weihnachten, Frank. Auch dir.” Sie zog aus ihrer Schürzentasche eine Zigarette, zündete sie an. Der Schnee machte ihre Haare weiß und nass. Sie lächelte.
“Du hast noch Kundschaft?” fragte Frank und blickte an ihr vorbei. Im Laden eine Frau mit unglaublich roten Haaren. Die rötesten Haare, die er jemals in seinem Leben gesehen hatte. Wie Feuer.
“Ja. Jedes Jahr am Weihnachtstag. Immer sie. Immer das gleiche Kleid. Ich mag sie sehr. Vielleicht gerade deshalb.”
“Ja?”
“Ja. Sie braucht das Kleid für Amerika, sagt sie. Weiß Gott, ob das stimmt, aber das ist egal.”
Frank sah abermals hin und fragte sich, woher er die Frau kannte. Es war nicht Nellie, natürlich nicht. Hatte er Leibrand von ihr erzählen hören, damals im Laden, nachdem er aufgewacht war?
“Jeder hat einen Traum”, flüsterte Martha und berührte Frank am Arm.
“Was hältst du davon, wenn du jetzt endlich deinen Laden zumachst, und wir holen uns etwas zu essen? Weil Weihnachten ist. Drüben warten meine Freunde, und sie würden dich bestimmt gern kennenlernen. Wir erzählen uns ein paar Geschichten.”
“Aber doch keine Geschichten, die sich alte Männer gern erzählen, oder?”
Frank lachte. “Sie werden dir gefallen, glaube es mir. Geschichten von Walfischen, Piraten. Und Mäusen.” Ohne darüber nachzudenken, beugte er sich vor und küsste ihre Wange. Martha berührte die Stelle und berührte dann seine Wange. Er nahm ihre Hand.
Die Frau mit den unglaublich roten Haaren strich aus der Tür, in ihren Händen den Karton mit ihrem Lieblingskleid. Sie hatte geweint, das sah Frank. Roch ihr Parfüm, von dem ihm schwindlig wurde. Hinter seinen Augen sah er Leibrand auf die Frau warten.
“Bis nächstes Jahr, Suzanne”, sagte Martha und winkte ihr solange, bis sie nicht mehr zu sehen war. Eine Sekunde lang glaubte Frank den toten Jungen dort stehen zu sehen, an jener Ecke, an der die Frau verschwunden war. Aber er blinzelte und niemand war dort. Außer Schneegespenster im Nachtwind.
“Manches Mal glaube ich, dass der Schnee nicht schmilzt auf ihren Haaren. Kannst du dir das vorstellen?” fragte Martha, holte ihren Mantel und machte das Licht aus.
Und natürlich konnte sich das Frank vorstellen.
Letztendlich konnte er sich alles vorstellen.
Text: Copyright © 2014 by Richard Lorenz
Illustrationen: Copyright © 2014 by Hanna-Linn Hava
Lektorat: Frank Duwald
Gefällt mir Wird geladen …