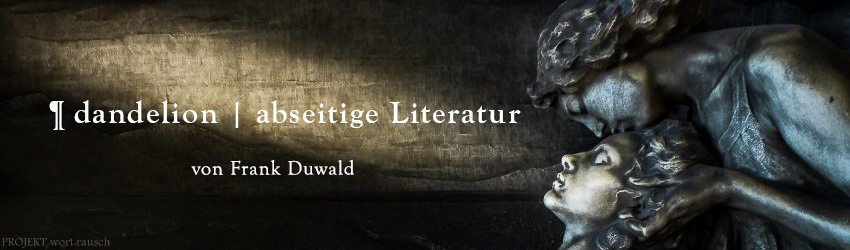Originalveröffentlichung:
Dracula (1897)

Dieser berühmteste aller Horror-Romane ist ein Dokument der sexuellen Verklemmtheit der Menschen des viktorianischen Zeitalters. Das übernatürliche Grauen, obgleich zuweilen ausgesprochen überzeugend dargestellt, ist nichts weiter als eine Schutzschicht, die den Blick auf die wahren sexuellen Gelüste und Traumata der gehemmten Viktorianer verschleiert.
Ich behaupte einmal, dass es für den modernen Leser unmöglich ist, Dracula von Bram Stoker zu begegnen, ohne ein Grundwissen dessen mitzubringen, worum es in dem Roman geht. Die Figur des Grafen Dracula gehört zur Weltkultur, und sie ist nicht nur ein literarischer Charakter, sondern ein Archetyp. Man beginnt hier also ein Buch zu lesen, über das man wohl oder übel mehr weiß, als einem lieb sein kann.
Doch dafür kann das Buch nichts!
Als es 1897 erstmals erschien, war es etwas Neues. Ein gewaltiges Update von J. Sheridan Le Fanus großartiger Vampir-Novelle „Carmilla“ [“Carmilla“] zwar, aber nichtsdestotrotz für den Großteil der damaligen Leserschaft etwas, das bis dahin in dieser Form niemand zuvor gelesen hatte.
Pirscht man sich als moderner Leser aus dieser Warte an das Buch heran, zieht man den größten Gewinn daraus – und erkennt, dass das verstreute Wissen über Dracula, dass man leider unweigerlich mit sich herum schleppt, einschließlich des Aussehens von Christopher Lee, lediglich Second-Hand-Wissen ist. Daher empfiehlt es sich, sich vor Lektüre des gedruckten originalen Dracula erst einmal dahingehend einzutackten. Dann ist man bereit für Dracula.
Als erzählerisches Mittel von Dracula wählte Bram Stoker eine bunte Ansammlung von Tagebucheinträgen, Briefen, Zeitungsartikeln und Dokumenten. Den Anfang macht das Reisetagebuch des Engländers Jonathan Harker, der als frisch gebackener Rechtsanwalt von seiner Kanzlei nach Transsilvanien geschickt wird, um für den Grafen Dracula den Kauf eines Hauses in London abzuwickeln.
Dieser Auftakt ist spektakulär. Die Reise Harkers, die ihn über Wien und Budapest bis tief in die Karpaten führt, ist grandios beschrieben. Der Wandel der Landschaften und der Menschen, die mit zunehmend östlicher Richtung fremdartiger und unheimlicher werden, setzt einen virtuosen Stimmungsrahmen für das, was folgen wird. In bester Schauergeschichten-Manier erreicht Harker – natürlich nachts und unter Wolfsgeheul – die düstere Burg des Grafen. Der stellt sich von Anfang an als geistreich, gebildet und zuvorkommend dar, kann aber auch etwas Zwielichtiges nicht verbergen. Die Merkwürdigkeiten mehren sich. Dracula ist nur nachts anzutreffen, isst niemals etwas und hat kein Spiegelbild. Schon bald wird Harker klar: er ist Gefangener in der Burg des Grafen.
Als Harker eines Nachts Draculas Warnung missachtet und sein Zimmer verlässt, wird er von drei jungen Damen überrascht, die nicht lange fackeln und mit “unverhohlener Wollust“ über ihn herfallen.
Die Szene öffnet eine Tür in die tieferen Gewölbe des Romans. Beschreitet man als Leser den Weg durch diese Tür, verlässt man den handlungsreichen Unterhaltungsroman, den Dracula zu sein vorgibt und gelangt in die Untiefen sexueller Phantasien, die im viktorianischen England freilich moralisches Sperrgebiet waren, denn eine autarke weibliche Sexualität war unerwünscht, und Frauen hatten bis zur Hochzeit Jungfrau und danach möglichst asexuell zu sein. Das Gebären von Kindern galt als einziger sinnvoller Zweck des Geschlechtsverkehrs.
Ausgerechnet der Roman, der ein ganzes Unterhaltungsgenre begründete, reißt die viktorianischen Wunden an jeder nur möglichen Stelle auf. Von männlichen und weiblichen Sexphantasien über sexuelle Dominanz, Homosexualität und Sex mit mehreren Partnern, bis hin zu Vergewaltigung ist alles da, über das Viktorianer beileibe nicht reden wollte.
Die Lust der drei Damen nach Blut ist der Lust nach Sex gleichzusetzen. Harker, den zu Hause die liebliche Vorzeigefrau Mina erwartet, setzt der aggressiven Sexualität der drei Schwestern nicht das Geringste entgegen. Wenn er in sein Tagebuch schreibt: “Irgendetwas an ihnen erregte mein Unbehagen, es war einerseits Verlangen, andererseits Todesangst“, dann scheint er in dem Moment lieber mit dem Tod für den orgiastischen Sex, der ihm bevorsteht, bezahlen zu wollen, als zurück in sein unaufgeregtes viktorianisches Leben zurückzukehren. Dass er später, jetzt wieder bei klarem Verstand, immer noch so zu denken scheint, belegt die Tatsache, dass er den Vorfall in sein Tagebuch niederschreibt, wohl wissend, dass Mina es irgendwann lesen könnte (was auch tatsächlich geschieht). Es ist ihm bewusst, dass dies Mina “Schmerz bereiten“ wird, aber das ist ihm in dem Moment völlig egal, denn “es ist die Wahrheit“. Harkers sexuelle Erregung wischt jegliche Vernunft derart heftig beiseite, dass er den Moment unbedingt für immer in seinem Tagebuch festhalten möchte. Das zeigt, wie sehr Harker die anerzogene viktorianische Steifheit abwerfen und die Verklemmtheit seiner Verlobten gegen die nymphomanische Aggression der drei Damen austauschen würde. Wie weit die viktorianische Unterdrückung sexueller Lust geht, wird deutlich, wenn man als Leserin und Leser in dieser Schlüsselszene gedanklich die Lust nach Blut gegen die Lust nach Sex austauscht.
Die Handlung verlagert sich anschließend nach England und führt uns direkt zu Minas Freundin Lucy Westenra, dem für mich interessantesten Charakter in Dracula. Die Briefe, die sie sich mit Mina schreibt, wirken wie ein geschwätziger mädchenhafter Gedankenaustausch, aber bei näherem Hinsehen sind sie alles andere als unschuldig. Lucy, die sehnsüchtig auf einen Heiratsantrag wartet, erhält plötzlich gleich drei Anträge an einem Tag. Da sie offenbar in keinen der drei Männer wirklich verliebt ist, kann sie sich nicht sofort entscheiden. An Mina schreibt sie: “Warum darf ein Mädchen nicht drei Männer heiraten […?]“, was dem Wunsch entspricht, mit drei verschiedenen Männern Sex zu haben. Ironischerweise wird ihr der Wunsch im übertragenen Sinne erfüllt, als sie ein Opfer des Grafen Dracula wird. Nachdem er ihr Nacht für Nacht das Blut aussaugt, bleibt sie nur durch die Bluttransfusionen eben der drei Männer (plus Van Helsing) am Leben, die um ihre Hand angehalten haben. Obwohl das Übertragen von Blut ein rein medizinischer Vorgang sein sollte, ist er in Dracula ein Akt der Intimität, der den Spendenden eine Nähe zu Lucy gibt, die exakt der des Geschlechtsakts entspricht. Über Arthur, dem Mann, den Lucy inzwischen geheiratet hat, wird später zum Besten gegeben, dass er seit der Bluttransfusion das Gefühl habe, “Lucy und er seien wirklich verheiratet und damit vor Gott Mann und Frau.“ Aus Angst vor der Eifersucht Arthurs beschließen die drei anderen Männer, ihre Blutspenden geheim zu halten, was ebenfalls auf eine starke sexuelle Kodierung hindeutet, denn warum sonst würde bei einer lebensrettenden Bluttransfusion eine Veranlassung zur Geheimhaltung bestehen?
Dies sind aber alles Dinge, die sich unter der trügerischen Oberfläche des Buches ereignen. Die eigentliche Handlung geht unterdessen zielstrebig weiter, denn Dracula nutzt die Vorbereitungen, die Harker für ihn getroffen hat, dazu, in England eine neue Basis zu errichten, die einer möglichen Invasion dienen könnte.
Wirklich furchteinflößend ist das Logbuch des Schiffes, das Dracula unerkannt nach England transportiert. Das Einlaufen des Schiffes in den britischen Hafen ringt Bram Stoker die stimmungsvollsten und düstersten Momente ab, die das Buch zu bieten hat. Die spürbare Beunruhigung der Menschen und die einhergehende atmosphärische Verfinsterung, die die Landung dieses Totenschiffes begleiten, erschaffen eine Vision der Apokalypse. Großes Unbehagen macht sich breit.
Um die Heimsuchung Lucys herum baut sich die Opposition zu Dracula auf, eine tapfere Männergruppe unter der fachlichen Leitung des holländischen Professors Van Helsing. Neben ihm besteht die Gruppe noch aus Lucys frischem Ehemann Arthur und den beiden anderen Verehrern Lucys sowie Jonathan Harker. Die Charakterisierungen der Männer sind dabei so oberflächlich und klischeehaft, dass man sie teilweise ohne Namensnennung nicht auseinanderhalten könnte. Alles Weitere an der Oberfläche ist lediglich purer Plot über den Kampf zwischen Mensch und Vampir.
Aber darunter …
Dracula kann in viele Richtungen interpretiert werden: Fremdenhass, Angst vor einer ausländischen Invasion, technischer Fortschritt gegen das Archaische etc. Aber mehr noch als all diese Deutungsvariationen scheint mir allein der Blick auf die Sexualität zum Fundament des Romans zu führen.
Etwas, worüber man in der Entstehungszeit von Dracula besser nicht redete, war Homosexualität. Dracula bietet viele Hinweise auf eine vorherrschende männliche Homosexualität. Beispiele dafür sind die Rasierszene zwischen dem Grafen und Harker sowie auch der Überfall der drei Vampirdamen auf Harker, den Dracula mit den Worten beendet: “Dieser Mann gehört mir!“ Aber nicht nur Dracula, auch die anderen männlichen Charaktere wirken eher schwul als heterosexuell. Je näher sie sich im Laufe der Handlung zu einer Art schwuler Bruderschaft zusammenschließen, umso salbungsvoller und leidenschaftlicher werden die gegenseitigen Bewunderungen geäußert. Die Biographen sind sich darüber hinaus ziemlich einig, dass Bram Stoker wahrscheinlich selbst schwul war.
Stoker gibt sich aber nicht nur mit einem Tabubruch zufrieden, der offen geschildert bereits bei Erscheinen für einen Skandal gesorgt hätte. Er lotet daneben sehr deutlich auch die Macht des Mannes über die weibliche Sexualität aus und zeigt die Hysterie der Männer, sobald sie feststellen, dass sie nicht mehr im Besitz dieser Macht sind. Die sexuelle Machtausübung gegenüber Frauen ist in Dracula sehr ausgeprägt. Wirklich abscheulich wird diese zentriert in Draculas Erniedrigung Minas, indem er sie zwingt, sein Blut zu trinken. In Wirklichkeit ist das eine Vergewaltigung, in der Dracula Mina zum Oralverkehr zwingt. In ihrer Qual sagt sie: “[Dracula] presste meinen Mund auf die Wunde, sodass ich entweder ersticken oder etwas davon schlucken musste […].“
Eine ebenso denkwürdige Szene ist die Pfählung Lucys durch ihren Ehemann Arthur. Dieser ist von Lucys plötzlichem aggressiven Sextrieb völlig eingeschüchtert und verängstigt: “Ihr Blick funkelte ruchlos, und über ihre Gesichtszüge glitt ein wollüstiges Lächeln.“ Angst jagt ihm insbesondere die drastische Veränderung von Lucys Libido ein, denn “[…] die ganze fleischeslüsterne und seelenlose Erscheinung wirkte wie eine teuflische Verhöhnung von Lucys lieblicher Reinheit.“ Wieder die Kontrolle über Lucy gewinnt Arthur, als er ihr den Holzpflock, das Phallussymbol schlechthin, “immer tiefer“ ins Herz rammt: “Der Körper zitterte und schüttelte und wand sich in wilden Verrenkungen.“ Als er sein Werk vollendet hat, kommt Arthurs Atem “in keuchenden Stößen“.
Mina ist letztlich der stille Kristallisationspunkt für jegliche Diskussionen über die Rolle der Frau im viktorianischen England. Sie wirkt asexuell, ganz so wie die Männer die Frauen gern haben wollten. Mina ist auch diejenige, an der sich die zu dieser Zeit alltäglichen patriarchalischen Repressalien am deutlichsten messen lassen, denn sie selbst erkennt schon früh im Buch ihre Rolle in der männlich dominierten Gesellschaft: “[…] und wenn mir nach Weinen zumute ist, so soll er es nicht sehen. Das ist wohl eine der Lektionen, die wir armen Frauen lernen müssen…“
Empfehlenswerte deutsche Übersetzung: Dracula, übersetzt von Andreas Nohl (Göttingen: Steidl, 2012)
Anmerkung: Es existieren alte Übersetzungen von Dracula, die man lieber meiden sollte, will man nicht auf all die zum Teil subtil verborgenen sexuellen Anspielungen verzichten. Die hier gewählte moderne Neuübersetzung von Andreas Nohl ist nicht unproblematisch, da Nohl (und dafür ist er inzwischen in der Branche bekannt) dazu neigt, den Originaltext zu glätten, sperrige Sätze zu begradigen und damit die Leseerfahrung zu vereinfachen.
Beinahe zeitgleich mit der Nohl-Übersetzung erschien die Neuübersetzung von Ulrich Bossier (Stuttgart: Reclam, 2012), von der ich dringend abraten möchte. Bossier erlaubt sich darin schlichtweg inakzeptable, das Original völlig verfälschende Freiheiten. So ist beispielsweise das letzte – sehr wichtige – Zitat meiner Besprechung in der Bossier-Übersetzung deratig schlampig und falsch übersetzt, dass es in dieser Version restlos unbrauchbar ist und von mir überhaupt nicht als bedeutsam erkannt worden wäre.
So hat man als Leser leider lediglich die Wahl, aus zwei Übeln das Geringere zu wählen.
Gefällt mir Wird geladen …