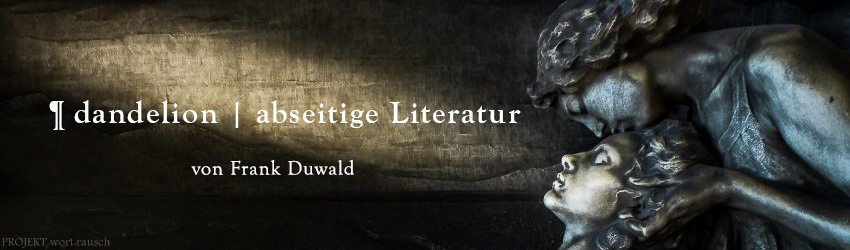Originalveröffentlichung: Amour dure (1887)
Ein junger Historiker entwickelt eine obsessive Liebe für eine seit Jahrhunderten tote femme fatale. Und er weiß sehr wohl, was er da tut, wenn er die zarte Spur ihres einstigen Lebens aufnimmt. In beeindruckend stimmunsvollen Bildern beschwört Vernon Lee in dieser Erzählung eine längst vergessene Epoche herauf.
Spiridon Trepkas Ausspruch “Ich habe mich der Geschichte verlobt, der Vergangenheit“ könnte wahrscheinlich stellvertretend für alle Texte Vernon Lees stehen, denn Zeit ihres Lebens war sie von der Vergangenheit fasziniert und erlaubte ihren Charakteren das, was ihr selbst im realen Leben (natürlich) versagt blieb: die Schemen der Vergangenheit mit ihnen in eine empathische Kommunikation treten zu lassen.
Wie fragil diese Kommunikation ausfallen kann, zeigt sich in Vernon Lees “Amour dure“ [“Amour dure“], einer ihrer gleichzeitig schön-schauerlichsten und folgenreichsten Erzählungen.
“Amour dure“, in Tagebuchform angelegt, belegt Spiridon Trepkas Reise in die italienische Gemeinde Urbania, jener von alten Kirchen, Steinpalästen und verwinkelten Gassen geprägter Region. Beginnend im Herbst 1885 stellt uns der Text einen mehr als galligen Erzähler vor. Gerade mal 24 Jahre alt und schon renommierter Geschichtsforscher, ist er seiner Wahlheimat Berlin, “diesem hassenswerten Babylon“, entflohen – einem Reisestipendium sei Dank. Seine Meinung über sich selbst ist nicht sehr hoch, sieht er sich doch als Pole, “der es dahin gebracht hat, einem pedantischen Deutschen zu gleichen, Doktor der Philosophie, ja sogar Professor, gekrönter Autor eines Essays über die Tyrannen des fünfzehnten Jahrhunderts“.
In der Folge konkretisiert sich das Objekt seiner Forschungen, denn schon “bevor ich hierher kam, fühlte ich mich durch eine sonderbare Frauengestalt angezogen, die mir in den ziemlich trockenen Blättern über diese Stadt […] begegnet war.“
Trepkas von giftendem Humor durchzogenes Tagebuch zentriert sich zunehmend auf Medea da Carpi, einer Dame höheren Standes, die vor rund 300 Jahren lebte und wegen ihrer “Schuld am Tod von fünfen ihrer Liebhaber“ im Dezember 1582 mit nur 27 Jahren unschädlich gemacht wurde.
Wie Trepka uns an Hand seiner Recherchen darlegt, war Medea eine Frau von gefährlicher Schönheit, deren Hinwendung keiner ihrer liebeskranken Anbeter überlebte. “Sie hat die magnetische Kraft, sich alle Männer dienstbar zu machen, die ihr in den Weg kommen“, schreibt Trepka.
Vernon Lee war ein viel zu unabhängiger Geist in einer Zeit, als Frauen praktisch entrechtet waren, dem modrigen Gesetzbuch des Patriarchats unterworfen, als dass sie Medea nur als eindimensionales femme fatale angelegt hätte. So ist Medea nicht nur abgrundtief verderbt; indem Vernon Lee die Geschlechterrollen vertauscht, ist sie auch Lees Medium einer kodierten feministischen Sprache. Medea folgt ihrer eigenen Gesetzgebung. Ihre Antwort auf Zwangsheirat und lebenslange Unterwerfung ist eine blutige Spur ihrer ausschließlich männlichen Opfer.
Wie schon Alice Okehurst aus “A Phantom Lover“ [“Oke von Okehurst“] dient auch Medea Vernon Lees leidenschaftlicher Anbetung des weiblichen Körpers. Wenn Trepka über Medea schreibt: “Der Teint ist blendend weiß, von der Durchsichtigkeit rosig angehauchter Lilien, wie er Rothaarigen eigen ist“, ist das vermutlich nicht nur die Beschreibung eines rein literarischen Charakters.
Es ist außerordentlich spannend mitzuverfolgen, wie Trepka sich an Medeas fast verblichenen Schatten heftet und sich immer tiefer in den Sog der Leidenschaft ziehen lässt. Verbunden mit den begnadeten Landschafts- und Gebäudebeschreibungen sowie traumhaften Stimmungsbildern einer antiken, unter der Stille fallenden Schnees geschmückten Landschaft, gehört Trepkas Fall in die obsessive Liebe zum Makellosesten, was die phantastische Literatur zu bieten hat.
Trepka, “ich melancholischer, armer Teufel, eine Figur wie Hamlet“, daran herrscht bald kein Zweifel mehr, verfällt Medea, die er bis dahin lediglich von gemalten Porträts kennt, zusehends. Seine Lebensbeichte macht ihn zu einer tragischen Figur: “Wo ist heutzutage eine zweite Medea da Carpi zu finden? (Denn ich bekenne, dass sie mich verfolgt.) Wenn es nur möglich wäre, einer Frau von dieser außerordentlichen, von dieser erhabenen Schönheit, zu begegnen, einer Frau mit dieser entsetzlichen Natur.“ Er verzweifelt daran, wegen seiner hohen Erwartungen sein Leben lang allein geblieben zu sein. Zunehmend seines Lebenswillens beraubt, ist er bereit, sich Medea als Opfer anzubieten, denn die “Dame meines Herzens“ materialisiert zunehmend für ihn. Erst sind es “Briefe von ihrer Hand“, denen “ein unbestimmter Duft wie von weiblichem Haar“ zu entströmen scheint, dann häufen sich die Zeichen, dass Medeas Epiphanie sehr bald bevorzustehen scheint.
Und dann ist endlich der Vorabend zu Heiligabend. Es schneit. Eisige Stille bedeckt das Land. Und Trepka schreibt in sein Tagebuch: “Die Liebe einer solchen Frau genügt, aber es ist eine verhängnisvolle Liebe. […] Auch ich werde sterben. Und warum auch nicht? Wäre es möglich, weiter zu leben, um eine andere Frau zu lieben? Wäre es möglich, ein elendes Dasein wie dieses länger zu ertragen, nach einem Glück, wie es der morgige Tag bringen wird?“
Deutsche Übersetzung: „Amour dure“, übersetzt von Susanne Tschirner auf Basis einer klassischen Übersetzung von M. von Berthoff, in: Vernon Lee, Amour dure (Köln: DuMont, 1990)
Anmerkung: Als Vernon Lees Inspirationsquelle für die äußerliche Beschreibung der Medea di Carpi wurde Agnolo Bronzinos Porträt der Lucrezia di Panciatichi ausgemacht. Man achte in vergrößerter Ansicht auf ihre Kette.
Mehr zu Vernon Lee auf dandelion | abseitige Literatur:
Vernon Lee | Winthrops Abenteuer
Vernon Lee | Oke von Okehurst
Vernon Lee | Die Puppe