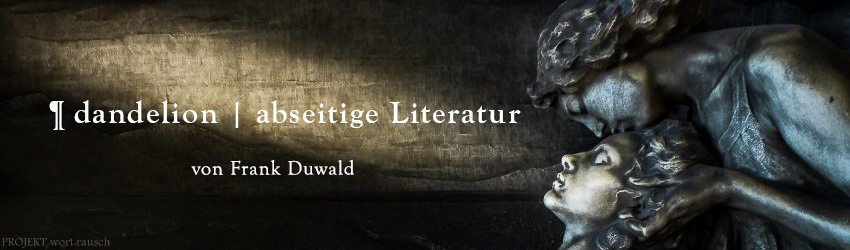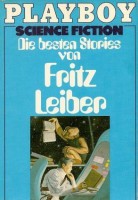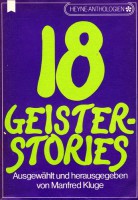Originalveröffentlichung:
Carmilla (1872)

In einem alten Schloss in der Steiermark freundet sich die einsame Ich-Erzählerin mit einer lesbischen, sexuell ausgesprochen aggressiven Besucherin voller Geheimnisse an. Eine der einfluss- und interpretationsreichsten Vampir-Geschichten, die – obwohl von einem Mann verfasst – dem viktorianischen Patriarchat feministische Leitgedanken vor die Füße wirft.
Eine der ältesten, einflussreichsten, aber auch heute noch bewegendsten Vampir-Geschichten und gleichzeitig eine frühe Bestandsaufnahme der viktorianischen gesellschaftlichen Geschlechterrollen ist die Novelle “Carmilla“ von J. Sheridan Le Fanu.
Zunächst 1871/72 in vier Teilen als eigenständige Geschichte in einem Magazin erschienen, bettete Le Fanu “Carmilla“ 1872 in seinen Geschichtenband In a Glass Darkly ein. Dabei werden die fünf Einzelgeschichten, einschließlich “Carmilla“, in eine Rahmenhandlung um den okkulten Detektiv Dr. Martin Hesselius eingefasst. Ich bevorzuge aber ohne Zögern den privateren und intimeren Ausschnitt der eigenständigen Veröffentlichung, da sich der nachträglich aufgesetzte pseudowissenschaftliche Rahmen aus In a Glass Darkly auf die Novelle eher schädigend auswirkt.
“Carmilla“ schildert die schaurigen Erlebnisse der neunzehnjährigen Laura, die nach einem Abstand von acht bis zehn Jahren (die Angaben im Text sind widersprüchlich; möglicherweise hat Laura mehrmals angesetzt, die Geschichte zu erzählen) darüber schreibt. Angesiedelt ist die Geschichte nach den groben Angaben im Text etwa Mitte des 19. Jahrhunderts.
Laura lebt mit ihrem Vater, einem Engländer, und ihrer warmherzigen Gouvernante und Ersatzmutter in einem Schloss (Le Fanu verwendet im Original das deutsche Wort) in der Steiermark. Ihre Mutter, “eine Dame aus der Steiermark“ starb so früh, dass Laura sie nicht mehr kennengelernt hat. Die Kulisse ist herrlich stimmungsvoll. Das Schloss ist weiträumig umgeben von nahezu unberührtem Wald, und das nächste Dorf ist relativ weit entfernt. Das Schloss hat alles, was eine derartig romantische Behausung braucht: einen Burggraben samt Zugbrücke, zahlreiche unbewohnte Räume und einen schmalen Weg, der in den Wald hinausführt.
Obwohl Laura sehr behütet aufwächst und ihr Vater außerordentlich gutmütig und liebevoll charakterisiert wird, ist ihr durchaus bewusst, dass sie ein ziemlich einsames Leben führt.
Eines Abends verunglückt eine mit überhöhter Geschwindigkeit fahrende Kutsche vor ihrem Schloss. Eine adelig scheinende Dame gibt vor, unbedingt in geheimer und lebenswichtiger Mission sofort weiterfahren zu müssen. Nur deswegen nimmt sie das Angebot an, ihre gesundheitlich angeschlagene und unter Schock stehende Tochter Carmilla spontan für mindestens drei Monate bis zu ihrer Rückkehr der Obhut des Schlossherrn zu überlassen.
Lauras Freude ist außerordentlich, endlich etwa gleichaltrige Gesellschaft zu haben. Die beiden verstehen sich auf Anhieb. Voller Zuneigung bewundert Laura die Schönheit Carmillas: “Sie war größer als die meisten Frauen“ und “[…] schlank und von wundervoller Anmut.“ Carmilla hingegen sieht Laura als “eine schöne junge Dame mit goldenem Haar und großen blauen Augen und vollen Lippen […].“ Das Paar strahlt eine für alle Leute verführerische Anmut und Unschuld aus, was später im Text gewissenhaft vom männlichen Handlungspersonal demontiert werden wird.
Schon bald geht Carmilla Laura sexuell sehr offensiv an, nutzt jede Gelegenheit zu Berührungen und Küssen. Zwischen den Zeilen ist Carmillas sexuelle Erregung praktisch greifbar: “Bisweilen fasste meine seltsame schöne Gefährtin […] meine Hand und drückte sie liebevoll, wieder und wieder; dabei schaute sie mich sanft errötend mit gesenkten Lidern glühend an und atmete so heftig, dass ihr Kleid sich im gleichen Rhythmus hob und senkte.“
Laura hingegen entwickelt zunehmend ambivalente Gefühle für Carmilla, die zwischen Anbetung und Abscheu pendeln. Laura, die den Beginn ihrer sexuellen Initiation aufgrund ihrer Abgeschiedenheit erst durch Carmilla erfährt, kann offensichtlich das, was sie denkt und das, was sie empfindet, noch nicht miteinander verknüpfen, was angesichts dessen, dass sie als Neunzehnjährige dank der Behütung ihres Vaters niemals auch nur annähernd mit Liebe und Sexualität konfrontiert worden ist, nicht verwunderlich ist.
J. Sheridan Le Fanu verbirgt das Erwachen von Lauras Sexualität hinter der Vampir-Thematik. Er gibt der Leserschaft schon recht früh genügend Hinweise an die Hand, dass es in diese Richtung geht, was für heutige Leser natürlich leichter zu durchschauen ist als für Leser des 19. Jahrhunderts, für die die künstlerische Darstellung des Vampirismus noch kein Allgemeingut war.
Unterdessen mehren sich die Zweifel an Carmilla. Sie bewegt sich auffallend träge, schläft bis mittags und besteht darauf, sich nachts in ihrem Zimmer einzuschließen. Auch erkennt Laura in Carmilla genau die Frau wieder, die sie als Sechsjährige im Traum aufgesucht und verängstigt hat. Daran, dass Carmilla Laura bereits zwölf Jahre vor ihrem Zusammentreffen real heimgesucht hat, besteht kein Zweifel.
In der Zwischenzeit häufen sich in der Umgebung die Fälle, in denen junge Mädchen plötzlich einer seltsamen Krankheit anheimfallen und nach kurzer Zeit sterben. Und dann wird auch Laura krank.
Am Ende stellt sich natürlich die Frage, ob eine Lebensform wie Carmilla wirklich etwas für Laura empfinden kann oder ob es nur ihre Gier nach Blut ist, die sie lenkt. Fest steht, etwas an Laura ist für Carmilla anders als an den anderen Mädchen, die ihre Opfer wurden. Einmal sagt Carmilla zu Laura: “Ich bin nicht verliebt und werde auch niemals lieben, […] es sei denn, dich.“ Obwohl Carmilla, Millarca, Mircalla, oder wie auch immer sie sich gerade nennt, die Jahrhunderte nach ihren Opfern durchstreift, verschont sie Laura bereits als kleines Kind. Und auch, wenn Laura feststellt, dass sie schon drei Wochen die Krankheit überlebt hat, während die anderen Mädchen schon nach drei Tagen sterben mussten, setzt sie das von den anderen Opfern auffallend ab.
Wie schon angesprochen, spielt sich hinter der Metapher des Vampirismus in “Carmilla“ einiges ab. So ist die Novelle im Subtext auch ein deutliches Statement zu den repressiven Lebensumständen der Frauen in einer von Männern dominierten Epoche. Die erotische Anziehung zwischen Carmilla und Laura reflektiert die Furcht der Männer vor den weitgehend im Geheimen liegenden Untiefen der weiblichen Sexualität. So sind es am Ende auch ausschließlich die männlichen Protagonisten, die wieder für ein überschaubares Terrain sorgen und Laura von ihrer irregeleiteten Sexualität “befreien“. Dass die Erlösung insbesondere für Laura möglicherweise unwillkommen ist, zeigt ihre anschließende Verlorenheit. Sie ist traumatisiert, verwindet den Verlust von Carmilla offenbar nie und empfindet das anschließende Alleinsein als unerträglich.
Empfehlenswerte deutsche Übersetzung: “Carmilla“, übersetzt von Bettina Thienhaus, in: Pam Keesey (Hrsg.), Draculas Töchter (Frankfurt am Main: Fischer, 1997)
Anmerkung: Mir sind vier deutsche Übersetzungen von “Carmilla“ bekannt. Die älteste davon, von Helmut Degner, in: Vampire (München: Heyne, 1967 plus zahlreicher Nachdrucke bei Diogenes), ist sprachlich sehr schön, hat gleichzeitig aber leider einen Hang zur Ungenauigkeit, Verallgemeinerung und Verkürzung. Die neueste Übersetzung von Katja Langmaier (Wien: Zaglossus, 2011) legt zwar Wert auf Werktreue, ist aber dem Original nicht gewachsen und stilistisch teilweise von geradezu ärgerlicher Qualität. Ein guter Kompromiss aus Werktreue und stilistischer Qualität findet sich in der Übersetzung von Anne Gebhardt, in: Martin Greenberg & Charles G. Waugh (Hrsg.), Vampire (Bergisch Gladbach: Bastei-Lübbe, 1987), obwohl auch sie nicht fehlerfrei ist. Den Hinweis zur o.g. empfehlenswerten Übersetzung von Bettina Thienhaus verdanke ich Malte S. Sembten (†), der mich auch noch auf folgende (mir nicht bekannte) Übersetzungen hingewiesen hat:
— “Carmilla“, übersetzt von Gertrud Baruch, in: Dieter Sturm & Klaus Völker (Hrsg.): Von denen Vampiren oder Menschensaugern (München: Hanser, 1968 plus zahlreiche Nachdrucke).
— “Carmilla”, übersetzt von K. Bruno Leder & G. Leetz, in: Karl Bruno Leder (Hrsg.): Vampire und Untote Genf und Hamburg: Kossodo, 1968). Vielen Dank an Malte S. Sembten für die wertvollen Informationen.