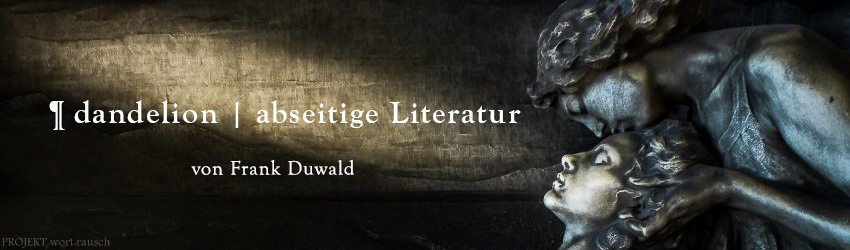Originalveröffentlichung:
The White People (1904, geschrieben 1899)

Das Grauen wohnt im Verborgenen. In dieser richtungsweisenden Novelle lauert es hinter den naiv klingenden Sätzen im Tagebuch eines sechzehnjährigen Mädchens. Die Schönheit der Worte täuschen beinahe darüber hinweg, dass hier in Wirklichkeit Unfassbares geschieht.
Kennt jemand das Gefühl? Man ist seit Jahren auf der Suche nach etwas Rarem, und völlig unerwartet, auf irgendeinem Flohmarkt, sieht man es plötzlich und kann es gar nicht fassen. Ähnlich geht es mir immer beim Lesen von Romanen oder Erzählungen, die so einmalig sind, so pur, dass man noch nie vorher etwas Derartiges gelesen hat und sofort merkt, dass eine ganz besondere Leseerfahrung folgen wird.
Der Waliser Arthur Machen ist so ein Autor, dem das bei mir bereits zweimal gelungen ist. Einmal mit seiner grauenerregenden, aber noch zeitweise recht trivialen Horror-Novelle “The Great God Pan“ [“Der große Pan“] und zum zweiten Mal mit seinem dekadenten, eskapistischen Künstlerroman The Hill of Dreams [Der Berg der Träume]
Mit der Novelle “The White People“ [“Die weißen Gestalten“] gelingt es Arthur Machen zum dritten Mal, mich mit etwas völlig Neuem, nie zuvor auch nur annähernd ähnlichem Gelesenen zu konfrontieren. Dabei könnte man “The White People“ vorschnell auf eine Zusammenführung der beiden genannten Texte reduzieren. Denn aus “The Great God Pan“ zieht sich “The White People“ das abgrundtief Böse und aus The Hill of Dreams die Schönheit und Natur des alten Wales mitsamt seiner römischen Artefakte. Aber, es wäre viel zu einfach, “The White People“ als eine geschickte Promenadenmischung aus “The Great God Pan“ und The Hill of Dreams anzusehen.
S. T. Joshi, der große aber auch polarisierende Literaturwissenschaftler beklagt in seinen Schriften immer wieder, dass das übersinnliche Element in vielen Werken der Phantastik nur zusätzlich aufgesetzt wird, ohne dass diese Art Literatur maßgeblich davon gelenkt wird. “The White People“ (wie auch vielen anderen Erzählungen Arthur Machens) kann man diesen Vorwurf beileibe nicht machen. Diese Novelle wird durchströmt vom Anderweltlichen. Das Unbegreifliche, das Unirdische, tränkt die Geschichte förmlich, und doch hat man beim Lesen überhaupt nicht das Gefühl, hier etwas Unrealistisches zu lesen. Das hin zu bekommen bedarf eines außergewöhnlichen schriftstellerischen Talents, aber auch kreativen Mutes.
“The White People“ beginnt bewusst steif mit einem philosophischen Altherrendialog über die Natur des abgrundtiefen Bösen. Was der Gelehrte Ambrose seinem Besucher Cotgrave zu erklären versucht, bleibt zwar schwammig, aber das macht nichts, denn Machen hat nicht im Sinn, uns eine einfache, leicht zu verstehende Geschichte zu liefern.
Was Ambrose dann zur Untermauerung seiner Thesen hervorzaubert – ein Notizbuch mit dem Titel Das grüne Buch –, hat es in sich. Das grüne Buch ist das Tagebuch eines sechzehnjährigen Mädchens, dessen Name nicht genannt wird. Keine alltäglichen privaten Bekenntnisse eines heranwachsenden Mädchens werden vor uns ausgebreitet, sondern die Einführung in eine Phantasiewelt, die möglicherweise auch nur im Kopf des Mädchens stattfindet. Sie (so nenne ich sie jetzt mal in Ermangelung eines Namens und, um sie nicht “es“ nennen zu müssen) plappert in fröhlichem und unbeschwerten Ton über ihre Geheimwelt, die sie ausschließlich ihrem Tagebuch anvertraut. Schon mit drei Jahren spricht sie in “Xu-Sprache“ und erinnert sich später an “die kleinen weißen Gesichter […], die mich anschauten, wenn ich in meinem Bettchen lag.“ Wenn sie so in Schriftform redet, fragt man sich, was oder wer ihr den Zugang zu einer Welt verschafft hat, in der es wie selbstverständlich “Aklo-Buchstaben“, die“Chian-Sprache“, “Mao-Spiele“, “Dôls und Jeelo“ und das “Königreich Voor“ gibt. Sowie weiße, grüne und rote Zeremonien, aber: „Die roten Zeremonien sind die besten […]“.
Bereits in diesem frühen Alter ist es das Kindermädchen, “schön und weiß mit langen schwarzen Haaren und dunklen Augen“, die die Gedanken des Kindes in eine geheimnisvolle Traumwelt lenkt. Es ist eine Welt voller Wunder und Mysterien, die einem phantasiebegabten Mädchen sehr entgegen kommen muss. Das Kindermädchen, selbst von ihrer Urgroßmutter in diese Art der Folklore eingeführt, weiht sie in Tänze und Gesänge ein, die geheim sind und nicht weitergesagt werden dürfen. Das wird immer wieder betont.
Arthur Machen bietet uns durchaus eine psychologische Erklärung für all das an, indem er sparsam einige Hinweise streut. Denn das Mädchen hat mit zwölf ihre Mutter verloren. Ihr Vater, Rechtsanwalt, vernachlässigt sie. Mögliche Gründe genug für ein einsames Mädchen, sich mit voller eskapistischer Wucht in eine merkwürdige Traumwelt zu stürzen. Doch ist es das, was wir Leser glauben sollen? Wohl kaum.
Daher schauen wir einfach weiter, wohin uns die Tagebuchschreiberin führt. Eines Tages macht sie eine Wanderung in den Wald. Ein kleiner Bach führt sie durch Gestrüpp und einen Tunnel in eine wahrlich andere Welt. Eine unendlich scheinende kahle Ebene voller außergewöhnlich großer “hässliche[r] Steine“ und Erdhügel. Sie verweilt dort und versinkt in fremdartige Visionen. Als letzte Station ihrer fast schon epischen Reise findet sie “einen besonderen Wald, der zu geheim ist, um beschrieben werden zu dürfen.“ Ambivalente Gefühle beschleichen sie: “[…] ich rannte und rannte so schnell ich konnte, denn ich fürchtete mich, weil das, was ich gesehen hatte, so wunderbar und so seltsam und so schön gewesen war.“
Hier liegt wohl der Kern von “The White People“. Das Mädchen ist sechzehn. Ihr sexuelles Erwachen ist unübersehbar, wenn man genau hinschaut. Denn immer mal wieder wandelt sich der naive Erzählton des Tagebuchs in eine erotisierte Sprache: “Ich fieberte, und mein ganzer Leib zitterte, und mein Herz pochte.“ Abends wieder allein in ihrem Zimmer, versucht sie sich vorzustellen “all die Dinge [zu] tun, die ich getan hätte, wäre ich nicht so furchtsam gewesen.“ Später, als sie noch einmal darüber nachdenkt, zittert sie, und es wird ihr “heiß und kalt zur gleichen Zeit.“
Doch was hat sie gesehen? Haben die Hexensabbate der folkloristischen, in den Tagebuchtext eingewebten Märchen und Überlieferungen sowie die Andeutungen zügelloser Orgien etwas damit zu tun? Und welche Rolle spielt die Tagebuchschreiberin dabei? Ich mag nicht darüber nachdenken.
Aber bereits als Achtjährige wird das Mädchen von ihrem Kindermädchen mit deutlich sexuellen Andeutungen konfrontiert – hier in phallischer Symbolik dargestellt. Das Kindermädchen zeigt ihr, wie man aus Lehm ein Götzenbild macht. Mit rituellem Gesang knetet sie “die seltsamste Puppe, die ich je gesehen habe […].“ Das Gesicht des Kindermädchens wird immer röter bei dem Ritual. Einige Tage später gehen sie wieder zu der Stelle, “wo der kleine Lehmmann verborgen lag“, inzwischen “hart“. „Der Himmel leuchtete in einem tiefen, violetten Blau […]“
Was ist nun das Besonderes an dieser meisterhaften Novelle?
Am außergewöhnlichsten finde ich die völlige Gegensätzlichkeit, von dem, was (und wie es) erzählt wird und dem, was hinter den Sätzen lauert. “The White People“ ist zunächst einmal die farbenfrohe Flucht eines einsamen, vernachlässigten Mädchens in eine spannende Welt der Mysterien, geschrieben in einem naiven und kindreinen Ton. Was sie aber in Wirklichkeit erzählen will, aber nicht darf, befindet sich ebenfalls in dem Tagebuch, aber man muss es suchen und entkodieren.
“The White People“ ist geprägt von diesem positiv strahlenden Erzählton und spektakulären Beschreibungen britannischer Naturidylle, dunkler Wälder und Teiche aber auch unirdischer Traumlandschaften von grandioser kunstvoller Pracht.
Dieser Schönheit zum Trotz klingen immer wieder kleine Misstöne im Tagebuch auf, die Unbehagen auslösen. Diesen Effekt hat Arthur Machen in Perfektion ausgeschöpft.
Man will und kann kaum glauben, dass irgendwo unter den schillernden Sätzen grenzenlose Perversionen lauern. Die Frage, die alles überlagert, lautet: Was nur wurde diesem Mädchen angetan?
Empfehlenswerte deutsche Übersetzung: “Die weißen Gestalten“, übersetzt von Sigrid Langhaeuser, in: Frank Festa (Hrsg.), Das rote Zimmer – Lovecrafts dunkle Idole II (Leipzig: Festa, 2010)
Anmerkung: Eine weitere gut zu lesende Übersetzung, von Joachim Kalka, erschien ebenfalls unter dem Titel “Die weißen Gestalten“ in: Arthur Machen, Die weißen Gestalten (München: Piper, 1993). Im direkten Vergleich scheint mir die Übersetzung von Sigrid Langhaeuser werkgetreuer und weniger umständlich. Der Machen-Kenner Marco Frenschkowski bemängelte in seinem Essay “Arthur Machens The White People – eine magische und erotische Initiation“ (erschienen in Das schwarze Geheimnis Nr. 1/1994) die “problematische, da in den mythologischen Anspielungen sehr freie“ Übersetzung von Joachim Kalka.
Mehr zu Arthur Machen auf dandelion | abseitige Literatur:
Arthur Machen | Der Berg der Träume